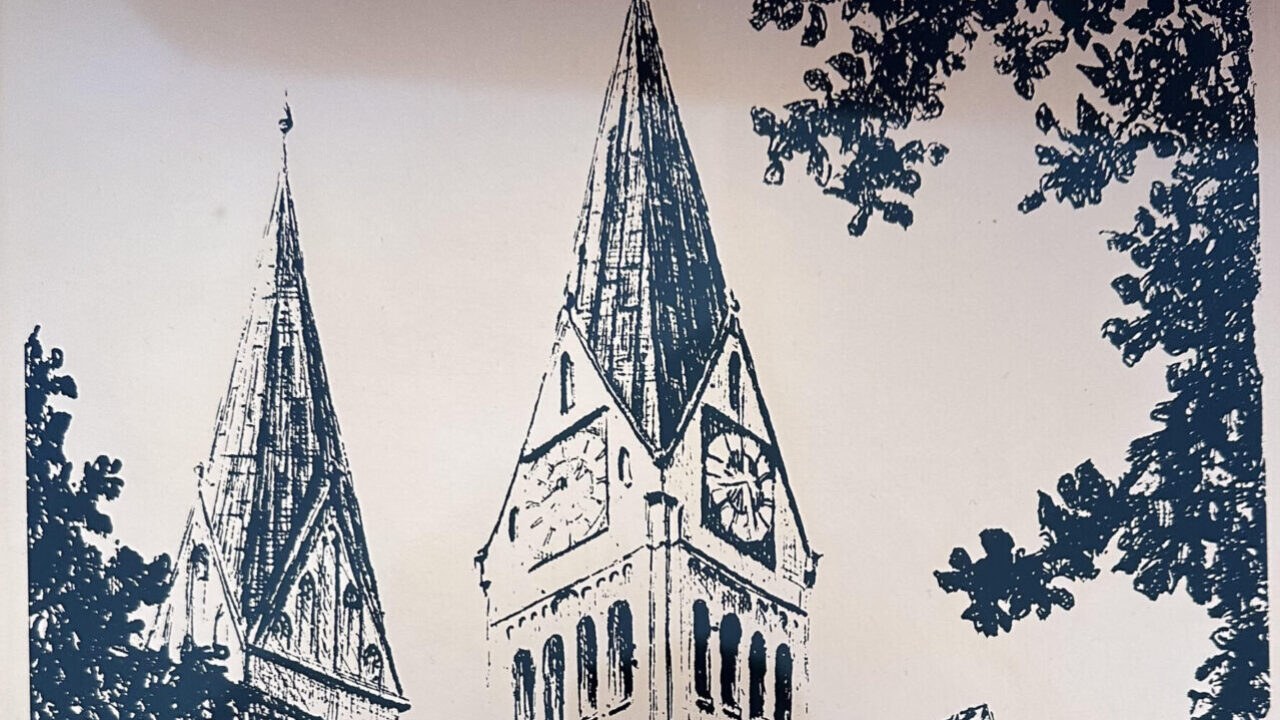„Der Mensch ist, was er isst.“ So lautet der bekannte Ausdruck eines deutschen Philosophen Ludwig Feuerbach. Nach Feuerbach, der hedonistisch beeinflusst und dem christlichen anthropologischen Denken gegenüber kritisch eingestellt war, ist das Sein des Menschen eins mit dem Essen; Sein heißt Essen; Erst im Essen erfüllt sich der Begriff des Seins. Der Philosoph legt großen Wert auf die Ernährung und macht das Sein des Menschen vom Essen abhängig. Die Auffassung von Feuerbach widerspricht unserer Glaubensüberzeugung und der christlichen Lehre, denn der Mensch ist zuallererst das Abbild Gottes. Trotzdem stellen sich für mich, persönlich, die Fragen, ob das Essen mein Sein bzw. mein Benehmen, mir selbst, und anderen gegenüber beeinflussen kann. Wie verhalte ich mich, wenn ich esse? Wird die Mahlzeit als eine Zeit verstanden, in der ich z. B. Gott für die mir gegebene Nahrung danken kann? Was heißt das für mich in Ehrfurcht und in Dankbarkeit die Gaben der Erde zu verzehren? Oder ist mein Verhalten etwa einem Tier ähnlich, nur den Bauch vollzustopfen, um Kilokalorien für das weitere „Funktionieren“ zu sammeln. Des Weiteren stellt sich die Frage, ob mein Verhalten und meine Einstellung zur Mahlzeit die göttliche Mahlzeit, den Eucharistieempfang widerspiegeln können?
Werfen wir einen Blick auf die Essensrituale bei den Juden und den Heiden und vergleichen wir mit der heutigen weit verbreiteten „Essenskultur“ in der Welt, werden wir einen gewaltigen Unterschied feststellen.
Zu Beginn der Mahlzeit bei den Juden nahm der Hausvater den Wein und sprach: „Gesegnet seist Du, Gott, unser Gott, König des Alls, Schöpfer der Frucht des Weinstocks“ und dann nahm er das Brot in die Hände mit den Worten: „Gesegnet seist Du, Gott, unser Gott, König des Alls, der das Brot aus der Erde hervorbringt.“ Lobpreis und Dankbarkeit Gott gegenüber für alle Gaben sind hier leitende Merkmale. Heidnische Symposien hatten eine Zweiteilung: ein Essensteil, dessen Ende mit einem Trankopfer auf den guten Dämon beendet wurde, und einen anschließenden Unterhaltungsteil. Auch hierzu gehörte eine Mahlzeit mit den gewissen Ritualen. Im Laufe der Jahrhunderte sahen sich die Christen verpflichtet Gott jederzeit für Speis und Trank zu danken. Ein wichtiger Teil des christlichen Glaubens war unter anderem die Gastfreundschaft.
Mit der Industrialisierung und Säkularisierung steht der moderne Mensch heute unter Zeitdruck. Sein Arbeitsplatz ist öfters weit entfernt vom Wohnsitz, so dass er immer wieder angewiesen ist, zwischendurch zu essen, ohne feste Mahl-Zeiten. Der Soziologe George Ritzer (Explorations in the sociology of consumption. Fast food, credit cards and casinos, London, New Delhi 2001, hier 162.) spricht, im Hinblick auf die Prozesse, von der zunehmenden „McDonaldisierung“ der Gesellschaft, in der Effizienz, Berechenbarkeit, Vorhersagbarkeit, Kontrolle von der größten Bedeutung sind. Der Mensch wird zum homo economicus mit der Einstellung: für MEIN verdientes Geld kann ich mir das Essen leisten und brauche dafür keinem mehr zu danken. In dieser Einstellung fehlt das Bewusstsein dessen, dass die Nahrung letztendlich Gottes Gabe ist. Dem homo economicus fehlt der ehrfürchtige Umgang mit den Speisen. Ich kann mich gut erinnern an meine Oma, die immer, bevor sie das Brot aufschneiden wollte, das Kreuzzeichen über ihm machte. Fiel ein Stück Brot auf den Boden, so musste man es aufheben und küssen. Wer macht das heute noch?
Der ehrfürchtige Umgang mit dem Essen wäre der erste Punkt zum Nachdenken, auch für uns. Es geht darum, dass man das Essen ganz bewusst zu sich nimmt und zwar mit Maß, indem man auch demütig und dankbar ist. Darüber hinaus merkt man heute, auch unter uns, ein gewisser Defizit am ehrfürchtigen Umgang mit der Tischgemeinschaft. Einige Regeln, die die Essenskultur zum Ausdruck bringen, wie z. B. das Tischgebet, oder auf alle zu warten, bis jeder was im Teller hat, erst dann zu essen zu beginnen, sind dafür da, um die Nahrungskonkurrenz zu zähmen und die Priorität der Gemeinschaft gegenüber dem leeren Magen jedes einzelnen zu sichern. Die Regeln beim Essen dienen einer gepflegten Atmosphäre und einem ungestörten Genuss des Mahles. Sie zielen auf ein gutes Geben und Empfangen der Speisen ab, dementsprechend ist das Ziel dieser Regeln gerechtes Teilen, das alle verbindet, ein Teilen, das die Gemeinschaft stiftet und stärkt. Ein wesentliches Merkmal der Tischgemeinschaft ist die Kommunikation und zwar nicht virtuelle in Facebook, sondern die Kommunikation mit denen, die gerade mit mir den Tisch teilen, die gerade von derselben Speise und demselben Trank gestärkt werden wie ich. Ein Beispiel einer guten Tischgemeinschaft bieten uns die Regeln des hl. Benedikt (RB 43; 63), indem er die Mahlzeit wie einen Gottesdienst zelebriert.
Für Benedikt ist die Einnahme der Speisen genauso wichtig wie ein Gottesdienst. Die profane Mahlzeit ist gleichsam das Vorspiel, ja eine Probe der Ehrfurcht, der Demut, der Dankbarkeit und der Gemeinschaft für die göttliche Mahlzeit, das Herrenmahl – Eucharistie. Denn in der ersten wird der Leib gestärkt und der zweiten die Seele. Dass einen Zusammenhang zwischen den beiden Mahlzeiten besteht, ist in 1 Kor 11, 17-34 gut erkennbar. In Korinth gab es zuerst ein Sättigungsmahl und erst danach die Eucharistiefeier. Diese beiden Teile trennten sich jedoch in den folgenden Jahrzehnten, dadurch, dass sich in der Gemeinde keine wirkliche Gemeinschaft bildete. Die reichen Christen bzw. diejenigen, die überpünktlich waren, haben, ohne auf andere zu warten, die besseren Speisen aufgegessen. Ihnen war es gleichgültig, auf andere zu warten, ihr egoistisch motiviertes Handeln missachtete den Rest der Gemeinde. Das ungerechte und egoistische Verhalten der Erstkommenden in Korinth kritisiert der Apostel. Paulus sieht in diesem Verhalten eine Verletzung der Gleichheit und auch den Verstoß gegen den Sinn der Eucharistie. Die Eucharistieteilnehmer werden so erneut am Tod Christi schuldig. Der Logik nach hat das Verhalten der Reichen beim Sättigungsmahl direkte Konsequenzen auf das Herrenmahl. Man kann die heilige Eucharistie erst dann würdig feiern, wenn man sich beim ersten Mahl korrekt und brüderlich benimmt. Wenn man ehrfürchtig, demütig und mit Dankbarkeit erfüllt die Nahrung zu sich nimmt, wird auch „durch das Gebet […] und Danksagung geweihte Nahrung“ (Justin, 1 apol. 66,2) besser schmecken. Im Brot und Wein wollen wir den Himmel schmecken! Durch den Empfang von Leib und Blut des Herrn wollen wir uns wandeln lassen! Lasst uns nicht so profan essen, wie Feuerbach es sagt. Nein, lasst uns vom Herrentisch essen, um zu leben und Leben in Fülle zu haben. Amen.