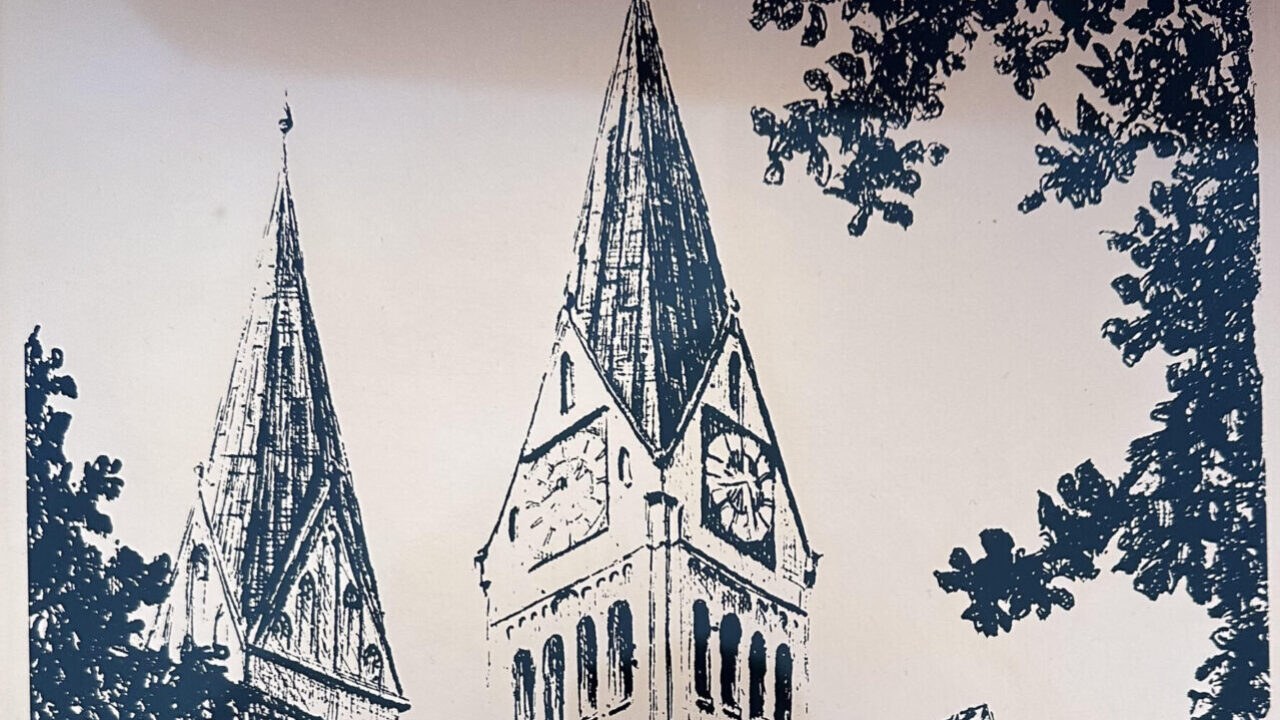Wenn man von den evangelischen Räten: Armut, Keuschheit und Gehorsam, hört, denkt man sich oft, sie seien bestimmt nur für Mönche in Klöstern oder für jene, die ein Versprechen vor Gott abgelegt haben. Diese drei haben mit dem geistlichen Leben eines Christen oder eines Seminaristen, und noch eines, der künftig heiraten will, nichts zu tun. Ist das tatsächlich so? Oder ist das Gegenteil der Fall? Von der Etymologie her heißt, die Räte sind im Evangelium zu finden. Es gibt aber keine direkte Stelle in den Evangelien, wo alle drei als Rat vorkämen. Man kann aber diese Ratschläge entweder aus den Worten Jesu oder aus den der Apostel schließen. Was den Rat der Armut angeht, so sagt Jesus z. B. in der Bergpredigt: „Selig, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich (Mt 5,3). In Mk 10,21 empfiehlt er dem reichen Mann, zu gehen, alles zu verkaufen, Geld unter die Armen verteilen und ihm nachzufolgen. So würde er einen bleibenden Schatz im Himmel erhalten.
Der Rat der Keuschheit oder der Jungfräulichkeit lässt sich von Mt 19,12 schließen, in dem gesagt wird: „Als die Jünger meinten, es sei besser nicht zu heiraten, antwortete Jesus: Nicht alle können dieses Wort erfassen, sondern nur die, denen es gegeben ist. Denn es ist so: Manche sind von Geburt an zur Ehe unfähig, manche sind von den Menschen dazu gemacht, und manche haben sich selbst dazu gemacht um des Himmelreiches willen.“
Was den Rat des Gehorsams betrifft, gilt hier Christus selbst, der bis zum Tod am Kreuz gehorsam war (Phil 2,8) und so den Willen seines himmlischen Vaters erfüllt hat (Mt 12,50). Wenn die Christen also die Vaterunser-Bitte „Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden“ aussprechen, zeigen sie sich bereit in allen Lebenslagen gehorsam den Willen Gottes zu sein. Manchmal ist so ein Gehorsam unter hartem Verzicht zu leisten[1].
Die uns heute bekannte Dreiteilung tritt erst im 12 Jh. in Erscheinung als Gelübde in der damaligen Chorherrenabtei St. Genoveva von Paris und prägt bis heute irrtümlicherweise unser Denken, die Räte seien nur für die Mönche.
„Nach Aussage der Kirchenväter bis hin zu Thomas von Aquin gehören die Räte nicht zum Wesen der Vollkommenheit, wohl aber helfen sie, diese leichter, sicherer und besser zu erlangen. Schon die »Vita Antonii« betont eigens, daß nicht die Länge der Zeit, sondern das Maß der Liebe und Entschlossenheit die wahre Anachorese darstellt. […] Die Ordensleute befinden sich also in keinem grundsätzlich anderen Stand als der Christ, der in der Welt lebt. Armut, Jungfräulichkeit und Gehorsam sind nicht schon an sich die Vollkommenheit, wohl aber führen sie als Mittel »leichter« zu ihr hin.“[2]
Gegen die sich im Mittelalter entwickelte Meinung, die Räte seien für Mönche und die Gebote für einfache Christen bzw. gegen das Zweiklassenchristentum sagt das II. Vaticanum, folgendes: „Daher sind in der Kirche alle, mögen sie zur Hierarchie gehören oder von ihr geleitet werden, zur Heiligkeit berufen gemäß dem Apostelwort: ‚Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung‘ (1 Thess 4,3; vgl. Eph 1,4). Diese Heiligkeit der Kirche tut sich aber in den Gnadenfrüchten, die der Heilige Geist in den Gläubigen hervorbringt […]. Sie drückt sich vielgestaltig in den Einzelnen aus, die in ihrer Lebensgestaltung zur Vollkommenheit der Liebe in der Erbauung anderer streben. In eigener Weise erscheint sie in der Übung der sogenannten evangelischen Räte. Diese von vielen Christen auf Antrieb des Heiligen Geistes privat oder in einer von der Kirche anerkannten Lebensform, einem Stand, übernommene Übung der Räte gibt in der Welt ein hervorragendes Zeugnis und Beispiel dieser Heiligkeit und muß es geben“ (LG 39).
Aus dieser Ausführung sind alle Christen, also auch Priester, unabhängig davon, ob sie zölibatär oder verheiratet sind, dazu berufen, nach Heiligkeit und Vollkommenheit zu streben. Denn die größte Gefahr für einen Christen, Priester oder auch Seminaristen sei die Gleichgültigkeit, sich um die eigene Heiligkeit nicht zu bemühen, auch wissend, dass er nur auf dem Weg dazu ist und dass dieses Bemühen ihn das ganze Leben lang begleiten soll. Die evangelischen Räte sind also nicht etwas, wofür man sich am Ende des Studiums oder gleich nach der Handauflegung des Bischofs entscheidet, sondern durch die Übung der Räte wird eine verantwortete Berufsentscheidung erst ermöglicht. Sie bereiten in Christen einen fruchtbaren Boden und gehören zum Spannungsfeld des Glaubens. Die Einübung der Räte in ihrer Ganzheit erweckt in jedem Christen das Ergriffensein vom Reich Gottes, die Faszination und die Hoffnung und innerlich treffen die Räte die menschliche Existenz in all ihren Formen. Diese Ergriffenheit drängt einen Menschen missionarisch in der Welt zu wirken und zwar durch das eigene Lebensbeispiel, das niemals aufdrängt, sondern sanftmütig und demütig einlädt. Darüber hinaus sind die Räte immer Ausdruck der Betroffenheit der Person und zugleich Ausdruck persönlicher Hingabe, offener Dienstbereitschaft, völliger Verfügbarkeit und vor allen großer Demut.[3]
Die Einladung Jesu‚ seid vollkommen, wie auch euer Vater im Himmel vollkommen ist‘ (Mt 5,48) hat nie an ihrer Aktualität und ihrer Wichtigkeit verloren und gerade jetzt, wo die Säkularisierung und Konsumdenken immer mehr zutage treten, braucht die Kirche lebendige Zeugnisse der Nachfolge Christi. Nur so werden auch die evangelischen Räte ausgelegt als Nachfolge, jeder in seinem Stand, wie ihn der Ruf Gottes getroffen hat, wobei einer, der als Priester noch verheiratet ist, muss besonders darauf achten, zusammen mit seiner Familie das Zeugnis dieser Nachfolge abzulegen. Vom Apostel wird jeder Christ gemahnt, zu leben, ‚wie es Heiligen geziemt‘ (Eph 5,3), und ‚als von Gott erwählter Heilige und Geliebter herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Geduld‘ anzuziehen (Kol 3,12), und die Früchte des Geistes zur Heiligung herbeizuführen (vgl. Gal 5,22; Röm 6,22). Da wir aber in vielem Fehler machen (vgl. Jak 3,2), bedürfen wir auch ständig der Barmherzigkeit Gottes und müssen täglich beten (Mt 6,12): ‚Und vergib uns unsere Schuld‘ (LG 40).
Nun stellt sich die Frage, wie steht das konkret im Leben mit Armut, mit Keuschheit und mit Gehorsam? Wie soll sich ein Christ verhalten? Sich um nichts kümmern und nur von der Hand in den Mund leben? Oder die Frage, ob man z. B. von Keuschheit in der Ehe sprechen kann? Und schließlich der zu versprechende Gehorsam, der manchen vielleicht schwerer fällt als Armut und Jungfräulichkeit zusammengenommen.
„Evangelische Armut meint wirklich leere Hände vor Gott und nicht einen Griffwechsel.“[4] Die Theologie der leeren Hände heißt vor Gott demütig und bittend um Vergebung hinzutreten wie ein Zöllner (Lk 18,9-14). Nicht aufgrund eigener Fähigkeiten bin ich so, wie ich bin oder besitze ich das oder jenes, sondern nur aufgrund der Gottes Gnade. Selig, die arm sind vor Gott (Mt 5,3) meint genau diese Einstellung, der Mensch habe vor Gott nichts vorzuweisen und vor ihm beuge er sich als ein Armer. So gesehen treten materielle Dinge in Hintergrund und werden dort bleiben, solange der Mensch an denen nicht hängt. Der aber, „wessen Herz [nur] an Reichtum und Besitz hängt, steht in äußerster Gefahr, den Anruf der Gottesherrschaft zu überhören und den »breiten Weg« zu gehen, der »ins Verderben führt« (Mt 13,4). Deshalb ergeht an alle [auch Priester] die Aufforderung, in einer letzten Distanz zum »Haben« zu leben (1 Kor 7,28f.).“[5]
Was den Rat der Jungfräulichkeit angeht, ist mindestens insofern von allen gefordert, als der Christ wissen muß, daß […] der Verheiratete »seine Ehe so führen soll, als führe er sie nicht« (1 Kor 7,29), nämlich so, daß sie nicht Letztwert ist, sondern sich »übersteigt« auf den kommenden Herrn hin.“[6] An dieser Stelle sei ein Mythos zu entlarven, in der Ehe ginge es nur um Vergnügung und Spaß oder ein weiterer Mythos, ein verheirateter Priester sei zwar Priester aber einer der zweiten Klasse, denn sein Herz sei ja geteilt. Dagegen kann man wohl vom Rat der Jungfräulichkeit in der Ehe sprechen, die anderes, wie bei einem zölibatären Priester oder bei Ordensleuten, zum Ausdruck kommt. Sie sei ein Bestandteil christlicher Existenz. Das „läßt sich zunächst am Begriff der »Jungfräulichkeit«, wird sie recht verstanden, deutlich machen. Christliche Jungfräulichkeit ist ein positives Existential christlichen Lebens: Jeder Christ hat sich um die Haltung der Jungfräulichkeit zu bemühen. »Jungfräulichkeit« meint ursprünglich nämlich jene eschatologische Grundhaltung, sich von dieser Welt »unbefleckt« zu halten. In diesem Sinn fällt der Begriff der Jungfräulichkeit mit dem der Armut zusammen, wie sie in den Seligpreisungen der Bergpredigt angeführt ist.“[7]
Katechismus der Katholischen Kirche spricht z. B. von der Keuschheit als einer sittlichen Tugend, zu der alle Getauften berufen sind, also Menschen in den verschiedenen Lebensständen: die einen im Stand der Jungfräulichkeit oder in der gottgeweihten Ehelosigkeit, […] die anderen, in der für alle vom Sittengesetz bestimmten Weise, je nachdem ob sie verheiratet oder unverheiratet sind. Verheiratete sind berufen, in ehelicher Keuschheit zu leben; die anderen leben keusch, wenn sie enthaltsam sind (KKK 2345-2348).
„Es gibt drei Formen der Tugend der Keuschheit: die eine ist die der Verheirateten, die andere die der Verwitweten, die dritte die der Jungfräulichkeit[…]“ (KKK 2349).
Und was Priesterfamilie betrifft, so können sie gerade jetzt ein Zeugnis christlichen Lebens in der Gemeinde ablegen.
Unter evangelischem Gehorsam versteht man freie apostolische Verfügbarkeit in allen Dingen dem Gottes Willen gegenüber. Alle Christen seien aufgerufen, „Jesus in seinem Gehorsam gleichförmig zu werden (Phil 2,5f.) und sich einander unterzuordnen (Eph 5,21).“[8]
Zusammenfassend also möchte ich sagen, dass die evangelischen Räte kein künftiger Priesterberuf sei, sondern hier und jetzt ihren Beginn haben und es sei der Mühen wert, auf diese Räte sich einzulassen. Die Räte sind schlechthin Grundform christlichen Lebens; speziell für Priester und sein geistliches Leben können sie auch hilfreich sein, wenn ihre Befolgung in der Bewältigung alltäglicher Situationen und weltlichen Angelegenheiten niederschlägt. Anderes gesagt, im Alltag erkennt man, ob der Christ oder der Priester das lebt, was er glaubt.
[1] Vgl. H. U. von Balthasar, Jesus nachfolgen – arm, ehelos, gehorsam, in: ZfB (Hrsg.), Treu Christi – Treu des Priesters: Beiträge zu einer Theologie priesterlicher Existenz, Freiburg 22016, 172-184, hier. 173
[2] M. Schneider, Die evangelischen Räte als Grundform christlicher Existenz (Radio Horeb 7. Juni 2016), 1-15, hier 4, in: https://patristisches-zentrum.de/radio/radio_2016/radio_2016_06.pdf
[3] Vgl. G. Jelich, Die Evangelischen Räte im Leben der Weltpriester. Vortrag auf der Regentenkonferenz am 17. Juli 1984 in Erfurt, 20-33, hier 21f.
[4] Ebd., 25.
[5] G. Greshake, Evangelische Räte und Weltpriestertum, in: Priesterliche Lebensform. Arbeitshilfen Nr. 36 Sekretariat der DBK (Hrsg.), Bonn 1984, 98-109, hier 99f.
[6] Ebd.
[7] M. Schneider, Die evangelischen Räte als Grundform christlicher Existenz
(Radio Horeb 7. Juni 2016), 6.
[8] G. Greshake, Evangelische Räte und Weltpriestertum, 99.