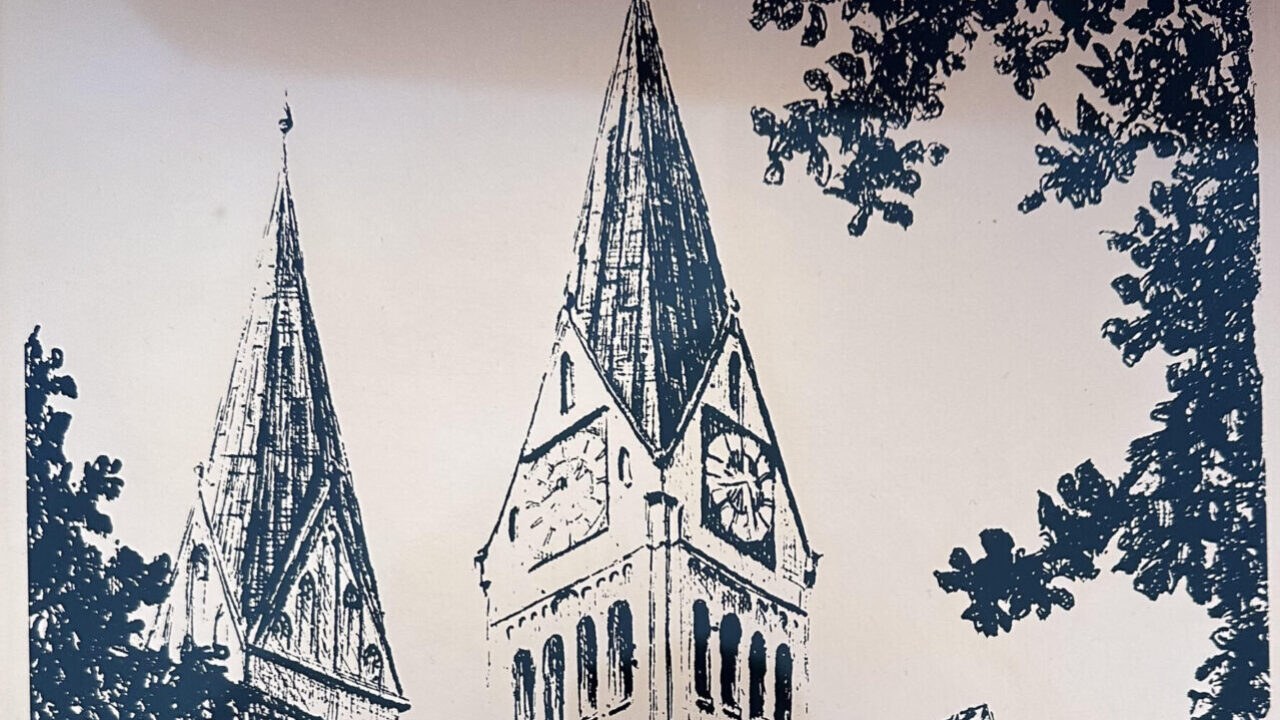In den 1970er Jahren schrieb Karl Rahner im Hinblick auf das Wandeln des Priesterbildes, dass die Position des Priesters innerhalb der Kirche und in der Gesellschaft sich ändern wird. Es wird nicht so sein, wie früher. „Altes ist noch, Altes verteidigt sich, Altes aber ist plötzlich nicht selbstverständlich und ist bedroht, Neues kündigt sich an, hat aber noch keine deutlichen Konturen.“[1] Nach fünfzig Jahren können wir heutzutage die von Rahner erwähnten Konturen dieses Wandels ein wenig erkennen. Nicht mehr die Volkskirche mit ihren Bräuchen und Sitten, nicht mehr kirchliche Mehrheit, die das Tempo eingibt und das Sagen hat, nicht mehr Priester als Hochwürden, die ihre Autorität mit Macht ausüben. Nein. Es wird nicht so sein, wie früher.
Nun stellt sich die Frage, in welche Richtung soll das weiter gehen? Welches Bild von Priester soll/muss sich ein Seminarist schon heute einprägen, um später in der Gemeinde glaubwürdig zu wirken? Welche Rolle hat dann der Priester in der Gemeinde? Einer, der nur als geistlicher Versorger in punktuellen Anliegen der Menschen wie Taufe, Trauung und Beerdigung, auftritt, oder einer, der der Gemeinde vorsteht und zusammen mit ihr vor Gott auftritt, was z. B. die Art und Weise der Zelebration in der byzantinischen Kirche bis heute zum Ausdruck bringen. Priester sein, qualitativ gesehen, sei kein besserer Christ zu sein, sondern einer, der besondere Sorge trägt für die Seelen der anderen und deren Freund ist. Das darf aber nicht nur einseitig verstanden werden, denn auch die Gemeinde, also jeder Getaufte soll ebenfalls die Sorgen für die anderen tragen, also „Priester“ füreinander sein, im Sinne der Teilhabe am allgemeinen Priestertum Christi.
Wer ist der eigentliche Priester? Das NT verwendet z. B. das Wort ἱερεύς31-mal, davon 14-mal in Hebräerbrief[2], in dem Christus alleine der eigentliche ἱερεύς sei und zwar nach der Ordnung Melchisedek. „So hat auch Christus sich nicht selbst die Würde verliehen, Hohepriester zu werden, sondern der zu ihm gesprochen hat: Mein Sohn bist du. Ich habe dich heute gezeugt. […] Er hat in den Tagen seines irdischen Lebens mit lautem Schreien und unter Tränen Gebete und Bitten vor den gebracht, der ihn aus dem Tod retten konnte, und er ist erhört worden aufgrund seiner Gottesfurcht. Obwohl er der Sohn war, hat er durch das, was er gelitten hat, den Gehorsam gelernt; zur Vollendung gelangt, ist er für alle, die ihm gehorchen, der Urheber des ewigen Heils geworden […]“(Hebr 5,5-10). Jesus, der Sohn Gottes (Hebr 4,14) und der Mensch zugleich (1 Tim 2,5) ist der einzige Mittler zwischen Gott und den Menschen. Als von Gott für ewig eingesetzter Priester bringt er Gebete und Bitten vor Gott, erweist die Gottesfurcht, ist gehorsam dem Willen des Vaters und allen – dies ist auch für uns von großer Wichtigkeit und von höchster Priorität…
„Die Neuheit und Einzigartigkeit des Priestertums Christi kann nicht durch einen anderen Priester fortgesetzt oder ergänzt werden, auch multipliziert sich das Priestertum Jesu nicht in der Kirche. Jeder Amtsträger handelt einzig im Namen Jesu, denn Christus selbst ist es, der tauft, predigt und Eucharistie feiert (SC 7).“[3] Wenn man die Schriften des NT unter die Lupe nimmt, findet man dort keine Stelle, wo Bischöfe, Presbyter und Diakone als Priester bezeichnet würden, vielmehr werden dort alle Getauften als Könige und Priester genannt (Offb 1,6), als „ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft“ (1 Petr 2,9). Es ist genau der Gedanke des II. Vaticanum, dass in Christus alle Gläubigen zu Priestern werden und als solche geistige Opfer durch Jesus Christus Gott darbringen (PO I,2). Die Konzilsväter unterscheiden aber zwischen verschieden Charismen und Diensten in der Kirche und vergleichen diese mit dem Bild des Leibes in 1 Kor 12: „Damit die Gläubigen zu einem Leib, in dem ‚nicht alle Glieder denselben Dienst verrichten‘ (Röm 12,4), zusammenwachsen, hat der gleiche Herr einige von ihnen zu amtlichen Dienern eingesetzt. Sie sollten in der Gemeinde der Gläubigen heilige Weihevollmacht besitzen zur Darbringung des Opfers und zur Nachlassung der Sünden und das priesterliche Amt öffentlich vor den Menschen in Christi Namen verwalten“ (PO I,2).
Nun stellt sich die Frage, wie konkret soll das aussehen? Oder, wenn alle Getauften Priester seien, braucht man noch sozusagen „besondere Priester“ und welche Rolle hätten sie dann in der Gemeinde?
„Das allen Gläubigen gemeinsame Priestertum besteht darin, dass sie an der Heilssendung der Kirche teilnehmen. Auf Grund der Taufe und Firmung sind alle Christen zur Verkündigung beauftragt, denn es herrscht ‚unter allen eine wahre Gleichheit in der allen Gläubigen gemeinsame Würde und Tätigkeit zum Aufbau des Leibes Christi‘ (LG 32). Deshalb erfüllt der Priester nur in der Gemeinschaft und Einheit mit der ganzen Kirche seine Sendung, d.h. er ist zuerst und vor allem Christ und steht in der Gemeinde, nicht über ihr.“[4] Das Bewusstsein aller Getauften und Gefirmten, das Evangelium Christi mit Worten und Taten zu verkündigen ist in den Gemeinden öfters nicht da. Dies aber könnte der Kirche neue Anziehungskraft und Glaubwürdigkeit geben. Denn der mystische Leib, Kirche Christi, kann nur funktionsfähig sein, wenn jedes Mitglied in diesem Organismus das macht, zu dem er berufen ist. Nicht von ungefähr betont ja 1 Petr 2,5 im Hinblick auf das Priestertum aller Christen: „Lasst euch als lebendige Steine zu einem geistigen Haus aufbauen […]“. Damit also das „geistliche Haus“ bestehen kann, muss jeder sich als lebendiger Stein in der Kirche erweisen.
Vor diesem Hintergrund kann es keine christliche Gemeinde ohne Bischof oder Priester geben, genauso wie Bischof und Priester ohne Gemeinde. Beide treten in eine Beziehung, die nur im Hl. Geiste möglich ist. Darum hat die „junge christliche Gemeinde ganz spezifische Begriffe gewählt: Der ‚Presbyter‘ verwaltet sein Amt nicht wegen seines biologischen Alters, wohl aber wegen seiner spezifischen Aufgabe in der Gemeinde; der ‚Episkopos‘ hat besondere Weise auf die Gemeinde zu achten, während der ‚Diakonos‘ ihr […] dient. Auffällig und wesentlich bei diesen Amtsbeschreibungen ist, daß die Begriffe sich nicht von kultischen Handlungen her bestimmen, sondern in Hinordnung auf die christliche Gemeinde und die Wahrnehmung des Lehramtes.“[5]
Nun warum führen sie alle dann den Begriff „Priester“? Sehr treffend erklärt dies Metropolit Zizioulas. Nach ihm will das Weihesakrament „den Menschen […] nicht zum Individuum machen, sondern zur Person, d. h. zu einem ek-statischen Wesen, das man nicht unter dem Gesichtspunkt seiner Grenzen betrachten kann, sondern insofern es seine Selbstheit überschreitet und ein beziehungshaftes Wesen wird. […] Im Lichte der koinonia des Heiligen Geistes schenkt die Weihe dem geweihten Manchen eine so tiefe und so wesentliche Beziehung auf die Gemeinschaft, daß er in seinem neuen Stand nach der Weihe, […], nicht länger in sich selbst begriffen werden kann.“[6]
Deutlich wird dieses Miteinander-In-Beziehung-Treten unter anderem bei der Bischofsweihe in der Eucharistiefeier. Sobald die Ektenie beginnt, nehmen alle anwesenden Bischöfe den Platz der Laien ein, oder bei einer Priesterweihe geht der weihende Bischof vor die Ikonostase, um damit zu manifestieren, „daß [er] vor aller amtlichen Differenzierung gleichrangige Glieder des einen, allen Christen gemeinsamen königlichen Priestertums [ist].“[7] Des Weiteren muss noch zwischen einem antiochenischen und einem kappadokisch-alexandrinischen Verständnis des Priesterbegriffs unterschieden werden. Das erste meint das Priesteramt als eine Gesandtschaft, indem Priester bei der Weihe die Gnade für die empfängt, die ihrer bedürfen. Das zweite wiederrum meint „aufgrund der verwendeten Begrifflichkeiten einer ontologischen Mißdeutung im Sinne einer persönlich empfangenen Weihegewalt nicht ganz verschlossen ist.“[8] Obwohl Gregor von Nyssa und Kyrill von Alexandrien das Weihesakrament als Verwandlung verstehen, meinen sie immer damit die Teilhabe, d. h. der Geweihter, indem er die Gnade des Priestertums empfängt, muss sich als Teil der eucharistischen Gemeinschaft verstehen und der stattgefundene Wandel wird hier mit Ausdrücken wie Ehre, Herrlichkeit und Würde beschrieben, also in Ausdrücken, die in erster Linie keine ontologische Verwandlung meinen, sondern ihren Schwerpunkt in der Anthropologie der Theosis, eines lebenslangen Streben des Priesters nach Heiligkeit.[9] „Der Geweihte wird also ein ‚Mittler‘ zwischen Mensch und Gott, nicht indem er eine Distanz zwischen beiden voraussetzt oder herstellt, sondern indem er sich selbst im Kontext der Gemeinschaft, von der er ein Teil ist, auf beide bezieht.“[10] Repräsentation durch Partizipation. Die Übernahme des Begriffs ‚Priester‘ für den Amtsträger ist nur so möglich und gerechtfertigt. Davon ausgehend ist die Rolle des Priesters nicht bestimmt von einer durch die Weihe erfolgten ‚Aufnahme in den Bereich des Göttlichen‘ […], sondern von seinem ministerium an der eucharistischen Versammlung her, der er zugeordnet ist als ‚Typos Christi‘ im epikletischen Gebet der Sakramente [sozusagen] die göttliche ἀναφορά zu verleiblichen.“[11] Der Priester steht nicht vor, sondern für Christus in der Gemeinde und sein Dienst ist als Stellvertretung Christi zu verstehen, jedoch nicht im Sinne eines abwesenden Christus, sondern im Sinne „Zeichen sein und Zeichen setzen für den gegenwärtigen und unmittelbar wirkenden Herrn, damit die Gemeinde sich ihm (dem Herrn) und seinem Wirken öffnet.[12]
Im Priester manifestiert sich auch der Außenbezug der ungeteilten Dreifaltigkeit, und wenn er in der Liturgie ausruft: „Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen“ bringt er genau das zum Ausdruck, dass nicht er opfert, sondern Gott, der durch ihn in Beziehung, ja in Kommunikation mit den Gläubigen treten will. Somit kann man das „Bild des Amtsträger verstehen als eine sichtbare Ikone des in Beziehung tretenden Gottes“[13]. Priester ist Ikone Gottes, wenn er die Menschen nach oben führt, genauso wie der auferstandene Christus Adam und Eva aus dem Hades nach oben zieht und sie am Handgelenk festhält. Am Handgelenk, am Puls des Herzen ja, am Puls des Lebens die Menschen zu halten und sie zu Christus zu führen ist die Lebensaufgabe jedes Priesters. Amen.
Zur Betrachtung: Gregor von Nazianz über das Priestertum[14]
„Hier bin ich, meine Hirten und Mithirten. Hier bin ich, heilige Herde, die du Christi, des Hohepriesters, würdig bist. Hier bin ich, mein Vater (sein leiblicher Vater, der ein Bischof in Nazianz war und Gregor gegen seinen Willen zum Priester geweiht hat); in allem bin ich besiegt, bin unterworfen, doch mehr den Gesetzen Christi, als weltlichen Gesetzen. Ich bin dir gehorsam. Gib mir dafür deinen Segen! Führe auch du mich durch deine Gebete, leite mich durch dein Wort, stärke mich durch deinen Geist! „Der Segen des Vaters baut den Kindern Häuser.” Möchten wir befestigt werden, ich und dieses geistige Haus, das ich erwählt habe und von dem ich wünsche, dass es mir in alle Ewigkeit zur Ruhe diene, wenn ich einmal von der irdischen Kirche zur himmlischen, zur „Versammlung der Erstgeborenen, die im Himmel eingeschrieben sind”, hinübergegangen bin. Dies ist meine wohlbegründete Bitte. Der Gott des Friedens, der „das Getrennte vereint”, der uns gegenseitig schenkt, der die Könige auf ihre Throne setzt, der „den Armen von der Erde aufrichtet und den Dürftigen aus dem Schmutze erhebt”, der David zu seinem Diener erwählt und ihn, obwohl er der letzte und jüngste unter den Söhnen des Jesse war, von seinen Schafherden genommen hat, der „den Verkündigern des Evangeliums die Gewalt des Wortes verleiht” zur Vollendung des Evangeliums,
[Gott des Friedens] möge unsere Rechte ergreifen, uns nach seinem Willen führen und mit Ehren annehmen, er, der die Hirten weidet und die Führer leitet, damit wir seine Herde mit Weisheit fuhren, wo für den Alten Segen beschieden war, und damit wir nicht „mit den Mitteln eines törichten Hirten” fuhren, wofür jenen Fluch zuteil geworden war. Möge Gott seinem Volke Kraft und Stärke verleihen! Er bereite sich in der Wohnung der Fröhlichen, im Glänze der Heiligen eine herrliche, unbefleckte Herde, welche der himmlischen Hürde würdig ist, auf dass wir alle, Herde wie Hirten, in seinem Tempel das Lob singen in Christus Jesus, unserm Herrn, dem die Ehre sei in alle Ewigkeit!“
[1] K. Rahner, Theologische Reflexionen zum Priesterbild von heute und morgen, in: K. Rahner, Schriften zur Theologie IX, Köln 1970, 373-392, hier 373.
[2] Vgl. A. Sand, Art ἱερεύς, in: EWNT II, 21992, 427-429.
[3] M. Schneider, Zur theologischen und pastoralen Grundlegung des priesterlichen Dienstes heute, in: Pastoralblatt 43 (1991), 66-74, hier 66.
[4] Ebd., 67.
[5] Ebd.
[6] J. D. Zizioulas, Priesteramt und Priesterweihe im Licht der östlich-orthodoxen Theologie, in: H. Vorgrimler (Hrsg.), Der Priesterliche Dienst V (Quaestiones Disputatae 50), Freiburg u. a. 1973, 72-113, hier 91.
[7] M. Kunzler, Porta Orientalis, Paderborn 1993, 434f.
[8] Ebd. 435.
[9] Vgl. ebd.
[10] Ebd.
[11] Ebd. 464.
[12] Vgl. M. Schneider, Zur theologischen und pastoralen Grundlegung des priesterlichen Dienstes heute, in: Pastoralblatt 43 (1991), 66-74, hier 68.
[13] Ebd. 462.
[14] Rede II,116f (BKV), in: https://bkv.unifr.ch/works/144/versions/163/divisions/90479
Diese Rede über das eigene Priestertum hielt Gregor zur eigenen Verteidigung, nachdem er flüchten musste. Die Rede diente dem hl. Johannes Chysostomos zur Inspiration für die Schrift „De sacerdotio“.