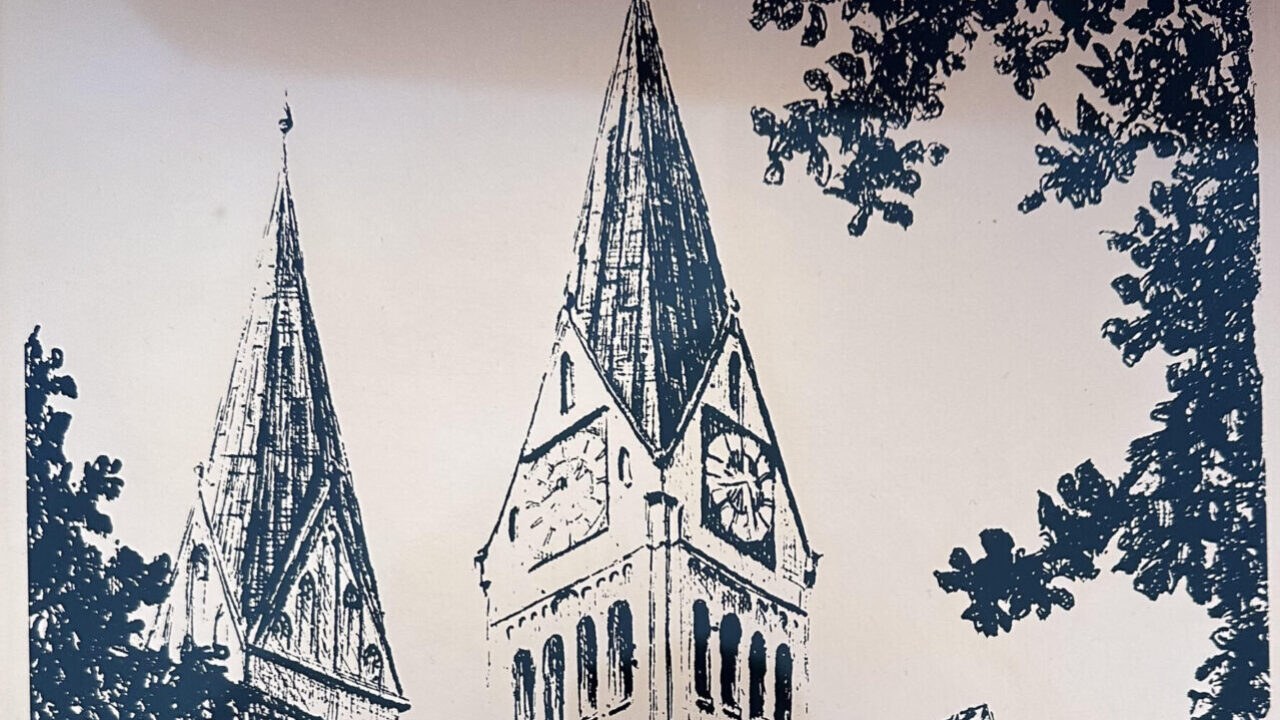In der frühen Kirche verließen die Mönche die »Welt«, um gerettet zu werden, d.h. um ein Leben nach dem Evangelium zu führen und das eine Notwendige zu suchen. Was damals ein neuer Anfang für die Kirche war, gerät heute unter anderen Vorzeichen in eine neue Konstellation: Wie in der frühen Kirche die Märtyrer ihre Botschaft und ihr Charisma an die Mönche weitergaben, so scheint die konkrete Gestalt des Mönchtums derzeit eine neue Umsetzung zu erhalten, nämlich in der allgemeinen Berufung aller Getauften zu einem »verinnerlichten Christentum«[1]. Statt der Trennung von der Welt und der Flucht in die Wüste bahnt sich heute eine ganz neue Form des Christseins an, nämlich das mit dem eigenen Leben gestaltete Glaubenszeugnis (Martyrion) mitten in der Welt. Zeichen für den ganz anderen Gott in dieser Welt zu sein, das will heute nicht in der »Wüste« gelebt sein, sondern an jedem Ort menschlichen Lebens und unter all seinen Bedingungen. Ein solches Zeugnis kann von jedem Christen gelebt werden, und zwar auf eine neue, eben verinnerlichte Weise. Kurz gesagt, es bedarf heute einer Spiritualität des »verinnerlichten Mönchtums«, oder besser: des verinnerlichten Evangeliums mitten in der Welt, wie Paul Evdokimov († 1970) und Anthony Bloom († 2003) es beschreiben.
Johannes Chrysostomus sagt hierzu: »Mönch und Weltmensch müssen zu den gleichen Höhen gelangen«[2], so dass die Lebensweise nach dem Evangelium für alle Christen gilt. Wiederum Johannes Chrysostomus: »Jene, die als Verheiratete in der Welt leben, sollen in allen anderen Punkten den Mönchen ähnlich werden […] Ihr irrt euch gründlich, wenn ihr glaubt, dass einiges von den Weltleuten verlangt wird und anderes von den Mönchen. Alle werden die gleiche Rechenschaft ablegen müssen.«[3] Nicht anders heißt es bei Theodoros Studites († 826) über Gebet, Fasten, Schriftlesung, Askese: »Glaubt nicht, dass diese Liste nur für den Mönch gilt und nicht auch, ganz und ebenso, für den Laien.«[4]
Das Evangelium lässt sich in jeder Lebenslage anwenden und dort übersetzen. Deshalb wundert es nicht, dass viele Mönche über ihre konkrete Lebensform hinausgewachsen sind. Seraphim von Sarov verlässt nach vielen Jahren der Einsamkeit seine Mönchszelle und kehrt in die Welt zurück, um künftig Ratgeber aller zu werden. In dem bekannten Gespräch mit Nikolaus Motovilov sagt er: »Daß Sie Laie sind und ich Mönch bin, daran brauchen Sie gar nicht zu denken […] Der Herr sucht Herzen, die von Gottes- und Nächstenliebe erfüllt sind. Dies ist der Thron, auf dem er sich niederlassen und auf dem er in der Fülle der himmlischen Herrlichkeit erscheinen will. ‚Mein Kind, gib mir dein Herz, und alles übrige will ich dir geben‘, denn im Herzen des Menschen ist das Gottesreich […] Der Herr erhört ebenso gern das Gebet des Mönches wie das des Laien, wenn nur beide den rechten Glauben ohne Irrtum bekennen, wirklich gläubig sind und Gott aus ihrer tiefsten Seele lieben. Wäre ihr Glaube auch nur so klein wie ein Senfkorn, beide würden Berge versetzen.«[5] Nicht anders der heilige Tykhon von Zadinsk [† 1767]: »Habt es nicht allzu eilig, die Mönche zu vermehren. Das schwarze Gewand rettet nicht. Wer ein weißes Gewand trägt und den Geist des Gehorsams, der Demut und der Reinheit besitzt, ist ein wahrer Mönch des verinnerlichten Mönchtums.« Dies lässt nach einer geistlichen Lebensordnung im Alltag fragen.
In einer Ehe stehen, als Priester oder als Mönch leben, Metalteile zu verpacken, am Fließbahn zu stehen, Gras zu mähen: All das ist nicht entscheidend, wohl aber dass der Mensch zur wahren Innerlichkeit findet und seiner selbst innewird. Die wahre Innerlichkeit des Menschen entspringt der unmittelbaren Erfahrung, dass er ein »Freund Gottes« und »Schatzmeister der göttlichen Menschenfreundlichkeit« (Gregor von Nazianz[6]) ist.
Diese wahre Innerlichkeit zu Gott und zu sich selber muss gesucht werden und vielleicht ist gerade jetzt die Zeit, während der Sommerferien, gekommen, diese zu finden.
Was bedeutet eigentlich das Wort „Ferien“?
Ferien leitet sich ab von lateinisch feriae und bedeutet „Feiertage“, „Ruhetage“, „freie Tage“, „freie Zeit“ und kommt ursprünglich aus der Gerichtssprache her. Im 16. Jahrhundert diente dieser Begriff an den Gerichten als Bezeichnung für einzelne gerichtsfreie Tage. Des Weiteren war feriae Bezeichnung für einzelne freie Tage an den Schulen und Universitäten. Auch Augustinus (Conf. 9,2) schreibt in seinen Bekenntnissen über Ferien der Weinlese, die als Festtage galten und groß gefeiert wurden. „Glücklicherweise waren nur noch wenige Tage bis zu den Ferien der Weinlese, und ich (Augustinus) beschloß, so lange noch in meinem Berufe auszuharren, um dann ehrenhaft abzutreten. [Zu dieser meiner Entscheidung] kam, […], daß durch angestrengte literarische Tätigkeit im Sommer meine Lunge angegriffen war, mir das Atemholen erschwerte und durch Brustschmerzen mir ihren leidenden Zustand verraten hatte. Meine frühere klare und volle Stimme versagte ihren Dienst, und ich war schon dadurch genötigt, die Bürde meines Amtes abzulegen, oder doch, um mich auszuheilen und gesunden zu können, eine Unterbrechung eintreten zu lassen.“
Die Sommerferien sind ja bald da und von uns hängt es ab, wie wir diese verbringen:
Vom 16. Juli bis 18. Oktober macht Gott Urlaub: er ist mit unbekanntem Ziel verreist und die Zentrale ist geschlossen. Wollen Sie eine Nachricht hinterlassen, dann sprechen Sie bitte jetzt. „pieps…“.
Wenn auch Mensch immer wieder in die „Fremde“ sich begibt, ist Gott, als barmherziger Vater, immer bereit, ihn in SEIN Haus aufzunehmen. Er steht mit den ausgebreiteten Armen und wartet geduldig.
Die Sommerferien bieten uns:
- Zeit für geistliches Auftanken
- Zeit für Erholung
- Zeit für Selbstfindung, Selbstorganisation und eigeständiges Handeln
- Zeit für Ferienbeschäftigung
- Zeit für Familienangehörige, Freunde, Bekannte
- Zeit, um einiges aufzuarbeiten, Streitigkeiten zu schlichten und Konflikte zu lösen
- Zeit, um ein interessantes Buch zu lesen, neue Sprachen zu lernen, Kultur zu erleben
- Zeit für Reisen, Bergwanderungen, Pilgerfahrten
- Zeit, um etwas neu zu beginnen, umzugestalten, neu zu bedenken
- Zeit, um eigenes Zimmer aufzuräumen
- Zeit, um für alles dankbar zu sein
[1] Vgl. P. Evdokimov, Gotteserleben und Atheismus. Wien 1967, 137ff.
[2] Johannes Chrysostomus, In Epist. ad Haebr. 7,4.
[3]Johannes Chrysostomus, In epist.ad Haelz. 7,41.
[4] PG 99,1388.
[5] Gespräch des Hl. Seraphim von Sarov über das Ziel des christlichen Lebens. Übers. von B. Tittel, Wien 1981, 67f.
[6] PG 35,593C.