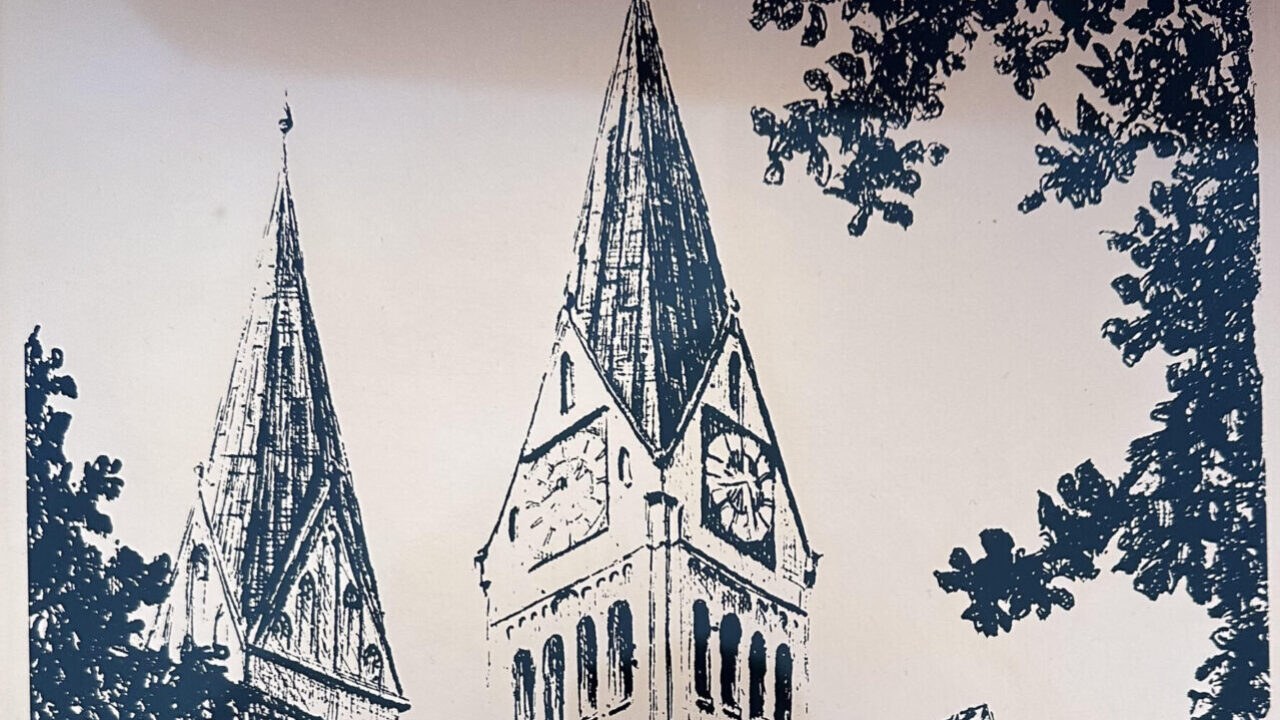Neulich wurde ich als Familienvater gefragt, ob unsere Kinder Halloween feiern, da es für Kinder ein schönes Fest sei. Diese Frage motivierte mich dem „Halloweenfest“ auf den Grund zu gehen und mich persönlich zu fragen, wie das Fest unsere Gesellschaft prägt, da es immer an Bedeutung und Zulauf gewinnt, nicht zuletzt durch kommerzielle Beweggründe. Neben dem Feiern und sich Amüsieren steckt in dem modernen Menschen der Wunsch, sich in Jenseits dieser Welt zu wandeln, mit den Geistern zu verkehren, ja mit dem Satan selbst in Berührung zu kommen. Zugleich habe ich am 1. November während einer Durchreise gesehen, dass die Menschen an Allerseelen auf die Friedhöfe gehen, um ihre lieben Verstorbenen zu gedenken. Neben der Tradition, Gräber zu schmücken, Kerze anzuzünden und vielleicht ein Gebet zu sprechen, steckt auch der feste Glaube dahinter, dass die Verstorbenen in eine andere bessere Welt hinübergegangen sind; sie ruhen in Gottesfrieden. In diesen meinen Vorüberlegungen sehe ich eine große Chance für die Kirche, die wir als Priestern und künftige Priestern nutzen müssen, um Menschen zu Christus zu führen. Da unsere Kirchen, sei es byzantinischen, malankarischen oder malabarischen Ritus einen unerschöpflichen Schatz besitzen, der aber den meisten Gläubigen verborgen bleibt, lohnt es sich diese Schatzkammer der liturgischen Gebete und des Gedenkens der Verstorbenen auszumachen und daraus zu schöpfen. Welche Bedeutung spielen also für mich das Gebet für die Verstorbene, Menschen, die ich lieb hatte, und die nicht mehr da sind. Es beginnt sowohl mit dem persönlichen als auch mit dem gemeinschaftlichen Gebet im Collegium Orientale. Wie z. B. betrachte ich das Totengedenken am Freitag nach der Vesper? Als 10 Minuten Überbrückung zum Abendessen oder als wertvolle Zeit, in der ich eine Kerze angezündet halte, in dem ich ewiges Gedächtnis singe, in dem ich ganz persönlich für die Verstorbenen aus meiner Familie bete und den Gottesdienst feiern darf.
Nun bevor wir zu der Gebetskammer für die Verstorbene in den Kirchen übergehen, möchte ich ein paar Sätze zu Halloween sagen, was als Ersatzfeier zelebriert wird, aber keineswegs dem Schöpfer, sondern anderen, mit denen auch der Erzengel Michael zu tun hatte.
Halloween hat wahrscheinlich seinen Ursprung im keltischen Fest Samhain, das am Vorabend des keltischen Neujahrs, dem 1. November, gefeiert wurde. Die Kelten glaubten, dass an diesem Tag die Grenze zwischen der Welt der Lebenden und der Toten verschwamm, was dazu führte, dass sie Lagerfeuer entzündeten und gruselige Kostüme trugen, um Geister abzuschrecken.
Nach der Christianisierung Europas wurde der 1. November als Allerheiligen etabliert, und der Vorabend, der 31. Oktober, wurde als All Hallows‘ Eve bezeichnet, was später zu „Halloween“ wurde.
Das kirchliche Fest der Allerheiligen hat, wie viele andere Feste, seinen Ursprung im Orient. Die Kirche in Orient gedachte an diesem Tag alle Märtyrer (siehe nur das Tageskondakion von Allerheiligen in der byzantinischen Tradition), die für Christus gestorben waren, aber deren Namen nicht mehr bekannt waren. Im 6. Jahrhundert wurde dieser Gedenktag in die lateinische Kirche aufgenommen, jedoch am 13. Mai gefeiert. Papst Gregor III. (731-741) dehnte das Gedenken nicht nur auf Märtyrer, sondern auf alle Heiligen aus. Offiziell wurde das Fest „Allerheiligen“ jedoch von Papst Gregor IV. (827-844) für die abendländische Kirche eingeführt und auf den 1. November verlegt. Eine Entscheidung, die dem heidnischen Fest ein Riegel setzen wollte.
Dass das Fest Allerheiligen und Allerseelen in der lateinischen Kirche zusammengekoppelt sind deutet auf eine gemeinsame Tradition mit der byzantinischen und der syrischen Kirche. Denn die Kirchen legen bis heute einen besonderen Wert aufs Gedenken aller Heiligen und der Verstorbenen und widmen ihnen sogar jeden Samstag in der Woche. Am Samstag nämlich, unmittelbar vor dem Auferstehungstag wird für die Verstorbenen gebetet. Die byzantinische Kirche besingt in einem Troparion Apostel, Märtyrer, Propheten, Hirarchen, Askethen und Gerechten, die den guten Kampf gekämpft und den Glauben bewahrt haben und so sollen sie uns allen zu Fürsprechern werden, da es nichts mehr im Wege steht, was sie, die Heiligen, vom Erlöser, Christus, trennen würde. Im Unison mit den Heiligen und sogar im gleichen Stimmton werden die Entschlafenen gedacht:
„Gedenke, Herr, in Gnaden Deiner entschlafenen Diener und vergib ihnen, was sie in diesem Leben gefehlt. Niemand ist ohne Sünde, nur Du alleine. Du kannst auch den Verstorbenen Ruhe schenken.“
Das Kondakion vereint beide Troparionen in einen Gesang und bringt alles auf den Punkt: Heilige und Verstorbene ruhen in Christus.
„Mit den Heiligen lass ruhen, Christus, die Seelen Deiner Diener dort, wo nicht Mühsal noch Trauer noch Klage, sondern nur Leben ohne Ende“.
Neben allen Heiligen spielt im ganzen Gedenken die Gottesgebärerin eine enorme Rolle; sie ist Mauer und Schutz und wohlgefällige Fürsprecherin, nur aus dem Grunde, dass sie das Heil der Gläubigen geboren hat.
Nicht nur am Wochentag werden die Verstorbenen zusammen mit den Heiligen gedacht, sondern auch am Samstag vor dem Sonntag vom Gericht, am zweiten, dritten und vierten Samstag in der vorösterlichen Fastenzeit und am Samstag vor Pfingsten; das letzte nennt man Allerseelen. Also, unmittelbar vor dem Pfingstfest werden die Toten gedacht und der erste Sonntag nach Pfingsten trägt den Namen „Allerheiligen“. Was also die Ostkirche und die Westkirche bezüglich des Totengedenkens unterscheidet, ist nur das Datum, nicht aber der feste Glaube, dass alle Verstorbene in Christus leben.
An Allerseelen beten wir die Gläubigen im Kondakion:
„Lass alle, die aus dieser Zeitlichkeit von uns geschieden sind, in den Zelten deiner Auserwählten wohnen und mit den Gerechten ruhen, unsterblicher Heiland. Haben sie auf Erden als Menschen gefehlt, dann vergib ihnen Du, sündloser Herr, ihre freiwilligen und unfreiwilligen Vergehen, da für sie eintritt die Gottesgebärerin, die Dich gebar, damit wir einstimmig singen für sie das Alleluja“. Ein Alleluja, mit dem nicht nur das Kondakion beendet wird, ein Alleluja, das mehrmals im Begräbnisritus erklingt, ein Alleluja, das auch unser Leben durchdringen soll.
Diese meine kurze Ausführung möchte einen Impuls setzen für das weitere Nachdenken für den heutigen Abend mit den anfangs gestellten Fragen:
Wie bete ich für die Verstorbene ganz persönlich und gemeinschaftlich?
Welche Rolle spielen für mich die Heiligen? Amen.