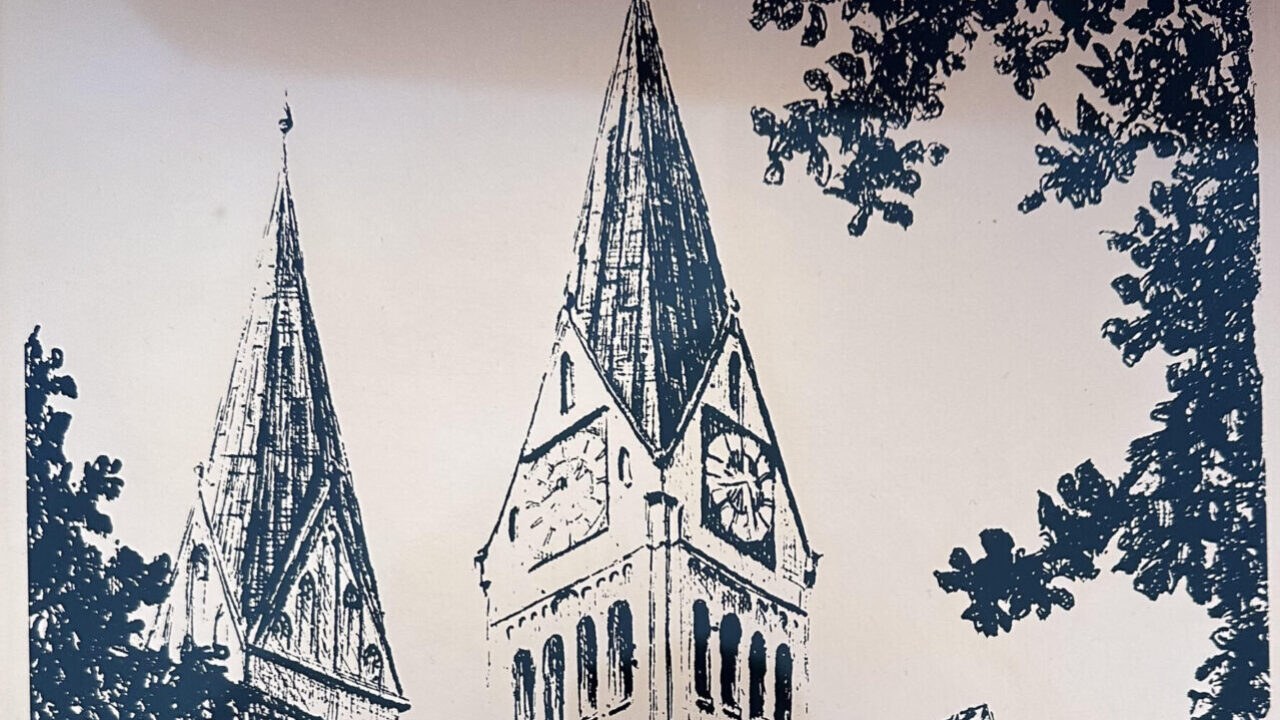„Priester müssen zuerst Menschen sein“.[1] Diesen Satz hörte ich als junger Seminarist im Jahre 2006 von dem Oberhaupt der Ukrainischen Griechisch-Katholischen Kirche, Seiner Seligkeit Liubomyr Huzar († 2017) bei einer Wallfahrt in Krylos in der Westukraine. „Ich will Mensch sein“ betonte Huzar immer wieder in seinen Predigten, Interviews und Veröffentlichungen. Als Beispiel brachte er unter anderem eine Erzählung des griechischen Philosophen Diogenes von Sinope (3 Jh. v. Chr.), der mit einer Laterne in der Hand am hellen Tag auf dem Marktplatz von Athen lief und auf die Frage, was er da mache, antwortete: Ich suche einen Menschen. Denn der Wunsch, Mensch zu sein, war für Huzar das Fundament und die Basis für weitere Dienste und Berufungen in der Gesellschaft und in der Kirche. Im Nachhinein kann ich den vor fünfzehn Jahren ausgesprochenen Satz von Huzar immer besser verstehen, besonders im Hinblick auf meinen jetzigen Dienst als Spiritual im COr. „Priester müssen zuerst Menschen sein“ – ein Spruch von fünf Worten, dessen Realisierung aber ein Leben lang dauert. Weil wir heutzutage eine Glaubenskrise erleben, ist es von großer Wichtigkeit, Priester auszubilden, die an die Ränder der Gesellschaft gehen und mit ihrem Lebenszeugnis die Menschen auf den Weg zu Gott führen können. Darum wird neben der intellektuellen, pastoralen und geistlichen Dimension in der Ausbildung der Kollegiaten ein besonderer Wert auf die vierte Dimension gelegt, nämlich auf die menschliche Reife des künftigen Priesters (vgl. Ratio Fundm. §§ 89-124). Diese ist nämlich, mit Huzar formuliert, die Basis für alles Weitere.
So wird in den nächsten fünf Bauschritten meines Beitrags auf einige Kriterien affektiver Reife eingegangen, wobei unter der affektiven Reife die gesamtmenschliche Reife zu verstehen ist. Mit Bauschritten ist die Vorgehensweise gemeint und am Bild eines Hausbaus soll sie deutlich dargestellt werden. Ein Haus zu bauen verlangt viel Arbeit, Mühe und Ausdauer, und gleichzeitig hängt das Bauen von Material und Wetterbedienungen ab, so entspricht es in gewissem Sinne auch der lebenslangen Baustelle zur menschlichen Reifung. Die unten genannten Kriterien werden aus „PASTORES DABO VOBIS[2]“erschlossen und dürften nicht nur für die Kollegiaten von Bedeutung sein, sondern für alle Menschen.
1. Affektive Reife = Reifer Umgang mit sich selbst
Affektive Reife meint, wie angedeutet, die zunehmende gesamtmenschliche Reifung auf allen Ebenen im Leben eines Menschen. Sie setzt ein gesundes Selbstverständnis, Selbstwertgefühl und die Fähigkeit zur Selbstannahme voraus. Denn jeder Mensch hat Stärken und Schwächen, Höhen und Tiefen, Licht- und Schattenseiten. Nur deren Annahme ermöglicht dem Menschen den Prozess zur Reifung, der sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Was das Selbstwertgefühl angeht, gilt der Grundsatz: Wie man sich selbst annimmt, so nimmt man auch andere Menschen an. Ein gesundes Selbstwertgefühl schafft Rahmenbedingungen für eine Fundamentlegung und ist ein in tiefer Erde gegrabener Umriss für den Bau. Zum Material, aus dem das Fundament gegossen wird, gehören verschiedene Komponenten (Zement, Sand, Steine, Wasser) ebenso ist es auch mit der affektiven Reife eines Menschen. Sie besteht aus vielen „Bau-Facetten“. Eine davon ist die Annahme und Integration von eigenen Gefühlen. Ob jemand über Gefühle sprechen und diese auch anderen zeigen kann, hängt damit zusammen, was für ein Charaktertyp er ist und ob/wie er als Kind seine Gefühle zum Ausdruck bringen konnte und wie diese verstanden wurden. Man kann den Grund einer Trauer anderen mitteilen, z. B. jemand aus der Verwandtschaft verstorben ist, man kann aber auch alles für sich behalten. Die Bandbreite der Gefühle ist groß. Sie reicht von „Alltagsgefühlen“ (z. B. schlechte Laune, Unlust) bis zu Emotionen, die man ungern zeigt und daher unterdrückt. Zu letzteren gehören beispielsweise aggressive und sexuelle Impulse, die besonders starke Kontrolle verlangen. Allerdings muss die Kontrolle von innen kommen, aus den Wertüberzeugungen und keineswegs aufgrund von Anpassung. Um ein attraktives Bild von sich zu zeichnen, um anderen zu gefallen (Eltern, Freundin, Leitung), werden diese Impulse „geheim“ gehalten, sie gehören dennoch zu dem jeweiligen Menschen, zu seinem Heim.
Die nächste Baukomponente ist die Fähigkeit, mit sich selbst allein zu sein. Hier geht es in erster Linie um zölibatäre Priester: Haben Sie Hobbies oder spezielle Interessen, die ihnen sehr wichtig sind? Oder benötigt ein zölibatärer Priester unbedingt häufige Kontakte zu anderen? Die Fähigkeit, allein sein zu können, ist Voraussetzung für das Gebetsleben. Jesus geht allein zu einem einsamen Ort, um dort zu beten (vgl. Mk 1, 35). Nicht nur für ehelose Priester ist die Fähigkeit, allein sein zu können, wesentlich, sondern auch für Mitglieder der Priesterfamilie, die möglichst gemeinsame Interessen haben sollten und auch ohne viel zu häufige Kontakte zu andern zufrieden leben können. Auch verheiratete Priester brauchen ihre „einsamen Orte“. Bevor das Fundament fertig gestellt wird, bedarf es noch einiger wichtiger Elemente und zwar: Das Wissen um die eigene Sexualität, die sexuelle Orientierung und deren Annahme sowie ein respektvoller Umgang mit dem eigenen Körper (Fettleiblichkeit?, Alkoholkonsum? und Rauchen?). Grundsätzlich sind Schwarz-Weiß-Urteile über sich selbst, andere Menschen oder Institutionen nicht erlaubt Das abschließende Element zu dieser Überschrift ist eine ausgewogene innere Stabilität, denn Instabilität in Entscheidungen, häufiger Wechsel von Lebensbereichen und Gesinnung sind nicht Vertrauen erweckend.
2. Beziehungsfähigkeit = Reifer Umgang mit anderen
Bleiben wir weiter bei unserem Bild vom Hausbau, so kommen nach der Fundamentlegung, die tragenden Wände ins Spiel. Diese tragenden Wände sind ein Sinnbild für einen reifen Umgang mit anderen. Die Fähigkeit dazu nennt man „Beziehungsfähigkeit“. Damit die Wände belastbar bleiben, bedarf es einiger wichtiger Elemente in unserem Bild: Bausteine. Einer davon ist Einfühlungsvermögen: Das ist ein Sensor, der dem Einzelnen hilft zu erkennen, wie andere denken oder was sie spüren. Wer diesen Sensor besitzt und ihn pflegt, hat die Fähigkeit zur Nächstenliebe und zum Mitleiden (vgl. Lk 15,20 u. a.). Viele, vor allem allein lebende Menschen (Priester sind da keine Ausnahme) laufen heutzutage Gefahr, sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen, sich zur Drehachse zu machen und andere für sich zu verzwecken. Ihre „selbstzentrierte“ Lebensweise kann ein Hindernis dafür sein, dass man sich an einen Dienst verschenkt, ohne sich selbst darin zu verlieren. Hierfür ist die innere Freiheit sehr wichtig. Als Beispiel dient uns Jesus, der sein Leben hingibt, um es wieder zu nehmen (vgl. Joh 10,17).
Ein weiterer Baustein ist die Fähigkeit sich einzufügen: Konkret heißt das z. B., ob sich jemand in die Seminargemeinschaft einfügen und persönlich einbringen kann, ob er sich, obwohl individuelle Person, als wichtiges und gleichwertiges Mitglied der Gemeinschaft versteht – und ob er dort offen seine Persönlichkeit zeigt ohne jemals eine Rolle zu spielen (eventuell aus einer Angst heraus).
Stabile Freundschaften sind weitere Bausteine in den Tragwänden unseres Gebäudes. Die Voraussetzung für jede Freundschaft ist gegenseitiges Vertrauen. So ist zu empfehlen, altersgemäße Freundschaften einzugehen und diese auch zu pflegen. Denn problematisch erscheinen Freundschaften, in denen der Altersunterschied sehr groß ist. Ein 25-jähriger findet viel mehr Gemeinsames mit seinen Altersgenossen als mit einem 13-, oder 50-jährigen. Jegliche freundschaftliche Beziehung setzt eine gewisse Opferbereitschaft voraus. Gute Beziehungen zu Gleichaltrigen sind ein wichtiges Weihekriterium und im Laufe der Priesterjahre helfen sie auf dem Priesterweg, viele Turbulenzen im Leben durchzuhalten und im Guten bis zum Ende auszuharren. Kein Wunder, dass Priester, die aus verschiedenen Gründen aufhören, priesterlich zu wirken, sich einsam fühlen, weil ihre Freundschaften öfters auseinandergehen.
Des Weiteren muss in diesem Zusammenhang erwähnt werden, ob und wie weit einem zölibatärer lebenden oder auch verheirateten Priester eine Freundschaft mit Frauen erlaubt ist. Hier gilt als Maßstab ein normaler und wertschätzender Umgang mit Frauen. Gefragt wird hier, wie und ob, auch im Umgang mit Andersgesinnten, eine gesunde Nähe-Distanz-Einschätzung eingehalten wird. Im Umgang mit Frauen kann bewusste Kontaktvermeidung keine Lösung sein, ebenso wie ein Don-Juan-Verhalten unangemessen ist. Erwähnt werden muss an dieser Stelle die Wohnung des Priesters, ob sie für ihn ein Heim ist, wo er sich auch stärken und erholen kann, oder eventuell nur eine Schlafunterkunft und Essenskühlschrank. Letzter Baustein für die Tragfähigkeit der Wände ist die Verlässlichkeit der Person (Einhalten von Absprachen, Versprechen, Terminen usw.). Die Basis dafür sind Selbstkritik und Ehrlichkeit sich selbst gegenüber. Dies ist aber der nächste „Arbeitsschritt beim Hausbau“.
3. Ehrlichkeit gegenüber der Wahrheit des eigenen Seins
Wie kurz angedeutet, ist dieser Punkt sehr wichtig, da er als „Deckplatte“ für die Tragwände des Gebäudes dient, indem sie alles, bis jetzt Gebautes verbindet und das Bauen des Dachstuhls ermöglicht. Ehrlichkeit gegenüber der Wahrheit des eigenen Seins beinhaltet verschiedene Aspekte wie z. B.: Das Wissen um eigene Grenzen: Niemand ist perfekt; kein Mensch ist ein „Alleskönner“ und keiner ist gefeit vor Versagensangst und vor Niederlagen. Man muss sich dessen bewusst sein, dass auch der Priester kein „Wundertäter“ sein kann, der, wie der auferstandene Christus, an mehreren Orten zugleich erscheint und mit den Jüngern das Mahl hält. Jeder und alles auf der Welt hat seine Grenzen – und das muss akzeptiert werden. Vor diesem Hintergrund ist Loyalität erforderlich, also Zuwendung mit Respekt und Vertrauen, aber ohne Idealisierung. Dies gilt für die Person selbst (Selbstachtung und Selbstvertrauen) ebenso wie in Bezug auf andere. Dazu müssen positive und negative Elemente integriert werden bei sich selbst, auch bezogen auf andere Menschen oder eine Gemeinschaft. Dieses Denken und Verhalten schützt vor grandioser Selbstüberschätzung wie Narzissmus und beugt der Abwertung anderer vor. Nicht weniger wichtig ist die realistische Einschätzung eigener und fremder Schwierigkeiten. Dieser Realismus kann leicht verloren gehen, hängt man der verkehrten Sichtweise an, dass kein Mensch normal sei. (Jeder habe einen „Vogel“, mal einen kleinen, mal einen größeren). Dabei findet man oftmals bei Menschen die Angst, in ihr eigenes Leben Einblicke zuzulassen. Manche verstecken sich hinter einer Mauer aus Abwehr und Anpassung. Zur Wahrheit des eigenen Seins und zur Ehrlichkeit, wie es um den Einzelnen steht, gehört auch sein Umgang mit dem Scheitern. Beleidigt man andere, ist Mut gefragt um Verzeihung zu bitten; wird man selbst beleidigt, sind Verständnis und Großmut aufzubringen, um zu verzeihen. Und wie es oft beim Scheitern passiert, muss einiges neu angefangen werden, müssen Prioritäten gesetzt werden, „innere Programme“ umprogrammiert oder gar deinstalliert und neu heruntergeladen werden. Dafür bedarf es der Fähigkeit das Scheitern realistisch als solches wahrzunehmen. Hier spielt eine wichtige Rolle, ob und wie man schon als Kind gelernt hat mit Scheitern umzugehen und die Erfahrung mit der Reaktion anderer auf das eigene Scheitern. Der Blick auf die eigene Vergangenheit und der Umgang damit sind bei dieser Problematik immer sehr hilfreich. Manches kann geklärt werden, wenn man die Vergangenheit kritisch unter die Lupe nimmt und gegebenenfalls versucht, verdrängte Themen aufzuarbeiten, auch im Gespräch mit dem geistlichen Begleiter. Denn, indem man davon spricht, erkennt man immer mehr, wie prägend die Kindheits- und Jugendjahre für die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit sind, nicht zuletzt auch bezüglich der Themen „Verantwortung“ und „innere Freiheit“, deren erste Erfahrung, oder medizinisch formuliert, Impfdosis schon dem Kind gespritzt wird.
4. Verantwortung und innere Freiheit
Verantwortung und innere Freiheit bilden, entsprechend der Logik meiner analogen Hilfskonstruktion, das „Dach“ als ein wichtiges und „oberstes“ Element für die menschliche Reife. Wie das Dach das gesamte Gebäude bedeckt und vor Unwetter schützt, so schützen Verantwortlichsein und innere Freiheit den Menschen vor verschiedenartigen Gefahren, so dass er „dicht“, ohne Beeinflussung von außen, d.h er selbst bleiben kann. Erste und wichtigste Verantwortung ist die für das eigene Leben. Wird das eigene Leben als Geschenk Gottes geschätzt, versteht sich auch der Mensch selbst als ein Geschenk. Und einer, der sich als Geschenk versteht, kann sich auch weiter verschenken. Kennzeichen für Übernahme von Verantwortung sind Initiative, Kreativität und Aktivität, einfach „mit dabei zu sein“ (z. B. im Seminar), denn passives Verweilen wie in einem Sanatorium mit Schlaf-, und Essensmöglichkeiten ist nur selten ein Zeichen von Verantwortungsübernahme. Dann ist die Gefahr groß, das eigene Leben an sich vorbeilaufen zu lassen. Sich treiben zu lassen und Unbeständigkeit sind Folgen davon. Um dies zu verhindern, ist stets eine kluge Planung nötig wie z. B. Arbeitsablauf, Wochenendaktionen, Urlaub. Damit der Arbeitstag produktiv wird, das Wochenende interessant und der Urlaub erholsam, sollte auch die eigene Gesundheit als wesentliches Element der Leistungsfähigkeit bewahrt werden. Jeder muss prüfen, was er für eine stabile Gesundheit tun kann (Bewegung, gesundes Essen, ausreichend Ruhe und Erholung usw.). Zum „Dach-Konstrukt“ gehört unabdingbar die Fähigkeit, klare und rechtzeitige Entscheidungen zu treffen, seien sie klein im Alltag, oder groß für den weiteren Lebensverlauf, (z. B. sich ehelos weihen zu lassen oder davor noch eine Familie zu gründen).[3]
Des Weiteren sind Arbeitsdisziplin und Zielorientierung wesentliche Bestandteile menschlicher Reife. Dazu zählt der angemessene Einsatz im Studium, realistische Freude über Fortschritte aber auch die Fähigkeit zur Distanz von der Arbeit und Erweiterung des Denkhorizonts durch Beschäftigung mit anderen Themen – und immer wieder auch kurze Phasen der Ruhe.
Was die Zielorientierung angeht, so müssen kurzfristige und langfristige Ziele gesetzt werden, immer mit dem Blick auf das endgültige τέλος (Ziel), ins Himmelreich zu gelangen. Wer das Ziel nicht kennt, findet auch den Weg nicht, denn das Lebensziel prägt den Lebensstil.
5. Engagement – Begeisterungsfähigkeit
Viele Häuser heutzutage haben im Dach einige Fenster, die einerseits Licht und Wärme in das Gebäude hineinströmen lassen, und andererseits Einblick in das Gebäude gewähren, also Information über das Innere des Hauses nach außen bringen. Ähnlich ist es, übertragen auf einen Menschen, mit Engagement und Begeisterung. Das Engagement entsteht bei einem aktiven Menschen durch die Information, die von außen in ihn strömt, und die Begeisterung strahlt dann aus seinem Inneren nach außen. Wer keine Freude am Engagement, keine Begeisterung für das Leben, das Tun, den Glauben, das Priesterleben und für das Himmelreich hat, wird auch andere nicht begeistern können, damit sie Leben in Fülle haben und voller Freude sind. Für einen Priester muss das Engagement für das Reich Gottes höchste Priorität sein, so dass er mit Lebensfreude und Begeisterungsfähigkeit andere Menschen mitreißt. Von großer Bedeutung, neben dem Engagement am Reich Gottes, ist sein Interesse an anderen Menschen, an Neuem oder Fremdem. Dieses erweitert nicht nur seinen Horizont, sondern zeigt auch, dass er nicht selbstzentriert und immer bestrebt ist, Mensch, Christ und Priester für sich und andere zu sein. Denn wer das eigene Haus [seiner menschlichen Reife] nicht bauen kann [oder will], wie soll er für die Gemeinde Gottes sorgen (vgl. 1 Tim 3,5).
[1] Meine Ausführung beruft sich auf Dr. Andreas Tapken, dessen Manuskript mir vorliegt.
[2] Nachapostolisches Schreiben von Papst Johannes Paul II. an die Bischöfe, Priester und Gläubigen über die Priesterausbildung im Kontext der Gegenwart (Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls 105), Bonn 1992, hier §§ 43-44.
[3] Vgl. F. Dillier, Warum verheiratete Priester? Begründung und Erfahrungen der ostkirchlichen Praxis, St. Ottilien 2001, hier 87-95.