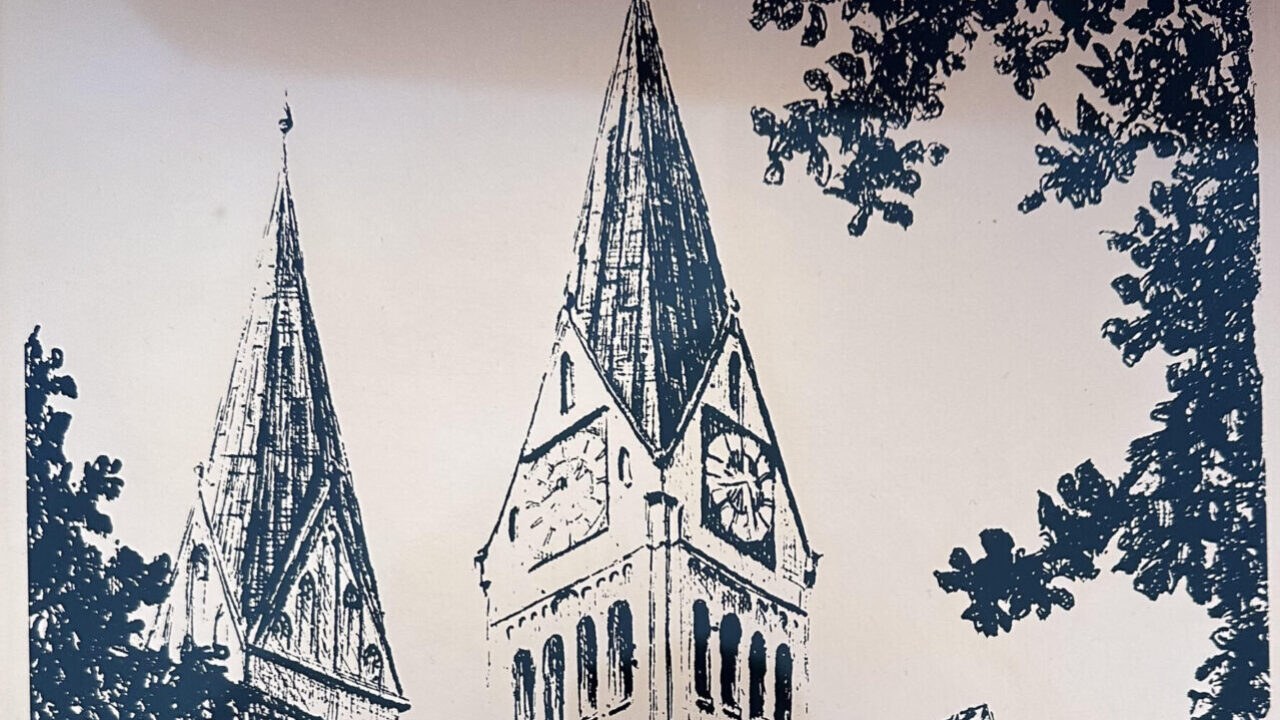Nur die wenigsten wissen, wer Joseph Mohr war, und nur die wenigsten haben es mitbekommen, dass nach seinem Tod am 4. Dezember 1848 inzwischen 175 Jahre vergangen sind. Er, der Autor des berühmten und weltbekannten Weihnachtslieds blieb im Hintergrund, nicht jedoch sein Werk, das in über 300 Sprachen und Dialekten in der Welt erklingt: Stille Nacht, heilige Nacht kennt jeder von Kindesbeinen an, natürlich in die Muttersprache übersetzt, ohne viel nachzudenken, wo das Lied entstanden ist, und wer sein Urheber ist. Joseph Mohr war Priester und Seelsorger in Österreich in der Nähe von Salzburg. Er hatte einen festen Glauben, stand, den Gläubigen in ihren Nöten nahe und wollte sie sorgfältig auf die Gottesdienste, vor allem aber auf das Weihnachtsfest vorbereiten. Warum will ich heute mit Euch darüber nachdenken? Was ist mein Ansinnen? Natürlich, da Weihnachten vor der Tür steht und wir alle sehsüchtig darauf warten, fiel dem Spiritual nichts Besseres ein, als über das Weihnachtslied „Stille Nacht“ zu sprechen, denkt man sich vielleicht. Oder der Spiritual will den eindrucksvollen Film „Stille Nacht“ empfehlen …Ja, dies spielte natürlich eine Rolle bei der Wahl unseres heutigen Themas, das den Namen trägt: ars celebrandi, auch als Anstoß im Hinblick auf das bevorstehendes Hochfest der Geburt unseres Herrn Jesus Christus. Über diese zwei, vielleicht für manche als fremd empfundene Worte möchte ich heute sprechen. Obwohl es für einen ostkirchlichen Seminaristen überflüssig erscheinen mag, sich mit dem Thema zu beschäftigen, da im Osten ohnehin alle Gottesdienste feierlich begangen werden, lohnt es sich trotzdem das Ohr offen zu halten.
Ars celebrandi ist (lateinisch ars „Kunst“ und celebrare „feiern, festlich begehen“) die Kunst, Gottesdienste zu feiern. Die ars celebrandi ist geprägt von einer Verbindung von Schönheit und Liturgie mit dem Ziel, das Gespür für das Heilige zu fördern. Dabei bedient sie sich „der äußeren Formen, die zu diesem Gespür erziehen, zum Beispiel der Harmonie des Ritus, der liturgischen Gewänder, der Ausstattung und des heiligen Ortes“.[1] So wie wir das aus den anderen Bereichen kennen, sei es eine Hochzeitsfeier oder eine Geburtstagsfeier, bedarf jeder Anlass einer sorgfältigen Vorbereitung. Eine Hochzeit in einer Müllhalle zu feiern ist nicht vorstellbar und Hochzeitsgäste in zerrissener und ungewaschener Kleidung zu empfangen ebenfalls nicht.
Nur ars, (Kunst), ohne das Feiern eines Dienstes für Gott, gleicht einem gut eingeübten Theaterstück, nur celebrare wiederum, also Feiern ohne Kunst des Zelebranten, das heißt ohne äußere Zeichen und Erklärungen, ist nur ein mechanisches Abspülen eines vordefinierten Prozesses . Das Verbindliche und Wesentliche in diesen beiden Polen ist Gott selbst bzw. Jesus Christus als Hohepriester und eigentlicher Hauptzelebrant. „Mit anderen Worten werden die Gläubigen mit der »ars celebrandi« eingeladen […] zu einer Innerlichkeit, die spürbar ist und die für die Anwesenden annehmbar und offenkundig wird. Nur wenn die Menschen sehen, dass dies keine rein äußerliche »ars« nach der Art eines Schauspiels ist […], sondern der Ausdruck des Weges unseres Herzens, das auch ihr Herz gewinnt, dann wird die Liturgie schön, dann wird sie zur Gemeinschaft aller Anwesenden mit dem Herrn.“[2]
Dass sich ars celebrandi sowohl der menschlichen als auch der göttlichen Seiten bedient, erklärt sich von selbst. Nach dem II. Vatikanum ist das Wesen „der wahren Kirche […] zugleich göttlich und menschlich […], sichtbar und mit unsichtbaren Gütern ausgestattet, voll Eifer der Tätigkeit hingegeben und doch frei für die Beschauung, in der Welt zugegen und doch unterwegs; und zwar so, dass dabei das Menschliche auf das Göttliche hingeordnet und ihm untergeordnet ist, das Sichtbare auf das Unsichtbare, die Tätigkeit auf die Beschauung, das Gegenwärtige auf die künftige Stadt, die wir suchen.“ (SC 2) Das Konzil spricht von Eifer der Tätigkeit, von sichtbaren Dingen, von der Tätigkeit der Beschauung, vom Gegenwärtigen, das auf das Künftige hinweist. All das vollzieht sich in der Liturgie, besonders in der Eucharistiefeier, die das Markenzeichen der Kirche werden will. Christus selbst ist darin gegenwärtig, „besonders in den liturgischen Handlungen“ (SC 7), deshalb müssen diese liturgischen Handlungen von Priestern würdig durchgeführt werden. Mit Herz und Blut, mit Ehrfurcht, Glauben und Liebe. Denn die liturgische Handlung eines Priesters ist die Tätigkeit auf die Beschauung für die Gläubigen, die aber vielen, ja sehr vielen Christen sowohl in West als auch in Ost, ungeklärt und unverständlich bleibt. Wenn also das Verständnis bei den Gläubigen fehlt, dann ist das Sakrament der Taufe zum Beispiel nur ein magisches Handeln, welches das Kind vor Unheil bewahren soll. Deshalb bitte ich Euch schon jetzt in der Formatio-Zeit darüber nachzudenken. Welches Liturgieveständnis habe ich? Will ich oder muss ich an den Gottesdiensten teilnehmen? Was ist meine Motivation, die dann besonders in den Ferien unter Beweis gestellt wird?
Meine lieben Mitbrüder! Liturgieprofessor und Priester Michael Kunzler schrieb in einem seiner Bücher: „Je mehr ein Priester das wahre Wesen der Liturgie versteht, desto mehr versteht er auch sein Priestersein,“[3] denn Priestersein heißt wesentlich „Liturge sein“. Und derselbe Autor feierte die Göttliche Liturgie nur dann, wenn die Gläubigen zuvor in die Symbolwelt des byzantinischen Ritus eingeführt wurden. „Es ist die Erfahrung, [so Kunzler], vieler schlecht gefeierter Gottesdienste, die genau das nicht vermitteln, was den Kern liturgischen Tuns nach der Überzeugung von Katholiken und Orthodoxen ausmacht: die Begegnung mit dem lebendigen Gott. Schlecht und vor allem lieblos gefeierte Gottesdienste können auch physische Qualen bereiten! Vieles kann diese Begegnung von Gott und Mensch unmöglich machen, zu hoffen bleibt, dass dies aus Unverstand geschieht und nicht aus bewusstem Wollen.“[4]
Meine Lieben! Möge Gott uns vor solchen Qualen bewahren! Um die Begegnung mit Gott uns selbst und den anderen nicht zu versperren, damit die Gottesdienste keine Qualen für uns sind, bedarf es innerer Vorbereitung, der Erkenntnis und vor allem des Wollens. All das ist nicht beim Internetsurfen, dem modernen Zeiträuber, zu erwerben, sondern durch ein sorgfältiges Studieren und Lesen der Heiligen Schrift und anderer Bücher.
Des Weiteren bedient sich ars celebrandi des liturgischen Gesangs. Dieser nimmt einen bedeutenden Platz bei Gottesdiensten ein. Zu Recht bekräftigt der hl. Augustinus in einer seiner berühmten Reden: „Der neue Mensch weiß, welches das neue Lied ist. Das Singen ist Ausdruck der Freude und – wenn wir ein wenig aufmerksamer darüber nachdenken – ist es Ausdruck der Liebe.“ Das zur Feier versammelte Gottesvolk singt das Lob Gottes.“ (Sacr. cart. 42)
Papst Benedikt warnt in seinem apostolischen Schreiben Sacramentum caritatis vor einer oberflächlichen Improvisation beim liturgischen Gesang oder vor Einführung musikalischer Gattungen, die den Sinn der Liturgie nicht berücksichtigen, und ihn dadurch misshandeln können. Folglich muss alles – im Text, in der Melodie und in der Ausführung – dem Sinn des gefeierten Mysteriums, den Teilen des Ritus und den liturgischen Zeiten entsprechen, soweit der Papst.
Liturgische Gesänge und ligurische Musik sind ein integraler Liturgieteil, keine parallele Ergänzung oder konzertartige Veranstaltung. Darum nimmt sich das II. Vaticanum zur Aufgabe, liturgische Gesangtradition zu würdigen und zu fördern. „In den Seminaren, […] Studienhäusern […] soll auf die musikalische Ausbildung und Praxis großes Gewicht gelegt werden“ (SC 115) und „die Sängerchöre sollen nachdrücklich gefördert werden, besonders an den Kathedralkirchen, [in unserem Fall im Collegium Orientale]. Dabei [wird eifrig Sorge getragen], dass in jeder liturgischen Feier die gesamte Gemeinde der Gläubigen mit Gesang [beteiligt wird].“ (SC 114)
„Die überlieferte Musik der Gesamtkirche stellt einen Reichtum von unschätzbarem Wert dar, […] weil dort das Verkündigungswort mit dem Gesang verschmilzt und so einen notwendigen und integralen Bestandteil der feierlichen Liturgie ausmacht. In der Tat haben sowohl die Heilige Schrift als auch die heiligen Väter den gottesdienstlichen Gesängen hohes Lob gespendet; […] So wird das Singen umso heiliger sein, je enger es mit der liturgischen Handlung verbunden ist, sei es, daß es das Gebet inniger zum Ausdruck bringt oder die Einmütigkeit fördert, sei es, daß es die heiligen Riten mit größerer Feierlichkeit umgibt“. (SC 112)
Dabei billigt die Kirche alle Formen von Kunst, unter Wahrung der Richtlinien und Vorschriften der kirchlichen Tradition und Ordnung sowie im Hinblick auf das Ziel, sich mit unserem Singen dem himmlischen Lobgesang der Cherubim und Seraphim anzuschließen und eigene Heiligung zu fördern. „Wir stellen auf geheimnisvolle Weise die Cherubim dar und singen der lebensspendenden Dreifaltigkeit den Lobgesang des Dreimal-Heilig. Lasst uns jede irdische Sorge ablegen.“ Wenn man also singt, werden unsere Sorgen, wenn nicht ganz abgelegt, dann bestimmt etwas kleiner…
Liebe Kollegiaten! Wie ich sagte, ist das Singen in der Liturgie sehr wichtig, deshalb wird dieses auch in den Gebeten des Priesters immer wieder erwähnt und betont, weil es „würdig und recht ist, Gott zu singen, Ihn zu preisen, zu loben und Dank zu sagen“. Solche Erwähnung findet ihren Höhepunkt im eucharistischen Hochgebet: „Mit diesen seligen Mächten, menschenliebender Herr, singen und rufen auch wir: Heilig bist Du und allheilig, Du, Dein eingeborener Sohn und Dein Heiliger Geist…“
„Ihre vornehmste Form nimmt die liturgische Handlung an, wenn der Gottesdienst feierlich mit Gesang gehalten wird“ (SC 113), sagt uns das II. Vaticanum. Wir sehen also, dass ars celebrandi ohne den Gesang und das Singen in der Liturgie unvorstellbar ist. Damit unser Leben als ständiger Gottesdienst gilt, ja zur Liturgie wird, sollen wir dankend zusammen mit dem Psalmist beten: „Ich will dem HERRN singen in meinem Leben, meinem Gott singen und spielen, solange ich da bin“ (Ps 104,33).
Joseph Mohr hat für seine Zeit die ars celebrandi gut verstanden und er vermochte sogar, seine menschliche Begabung und sein Mühen mit dem göttlichen Wirken in einen harmonischen Klang zu bringen, das Gespür für das Schöne, ja für das Heilige zu verleihen, die Sprache der Musik zu wählen, die durch das Herz ging, Frieden und Freude schenkte und ein Stück Himmel erfahrbar machte, denn Jesus der Retter ist da…
So möge dieser Impuls uns alle ermutigen, würdig, gottgefällig und schön, Gottesdienste entweder selbst zu feiern oder mitzufeiern. Die Weihnachtszeit eignet sich perfekt dafür, ars celebrandi zu praktizieren, um durch die irdische Liturgie an jener himmlischen Liturgie vorauskostend teilzunehmen.[5] Möge uns nur der Geschmack nicht vergehen, denn Priestersein heißt „Liturgesein“. Amen.
[1] Vgl. Nachsynodales apostolisches Schreiben SACRAMENTUM CARITATIS seiner Heiligkeit Papst Benedikt XVI., 40.
[2] Begegnung von Papst Benedikt XVI. mit Priestern der Diözese Albano, Apostolischer Palast in Castelgandolfo, 31. August 2006.
[3] M. Kunzler, Liturge sein. Entwurf einer Ars celebrandi, Paderborn 22009, 2.
[4] Ebd., 17.
[5] SC 8.