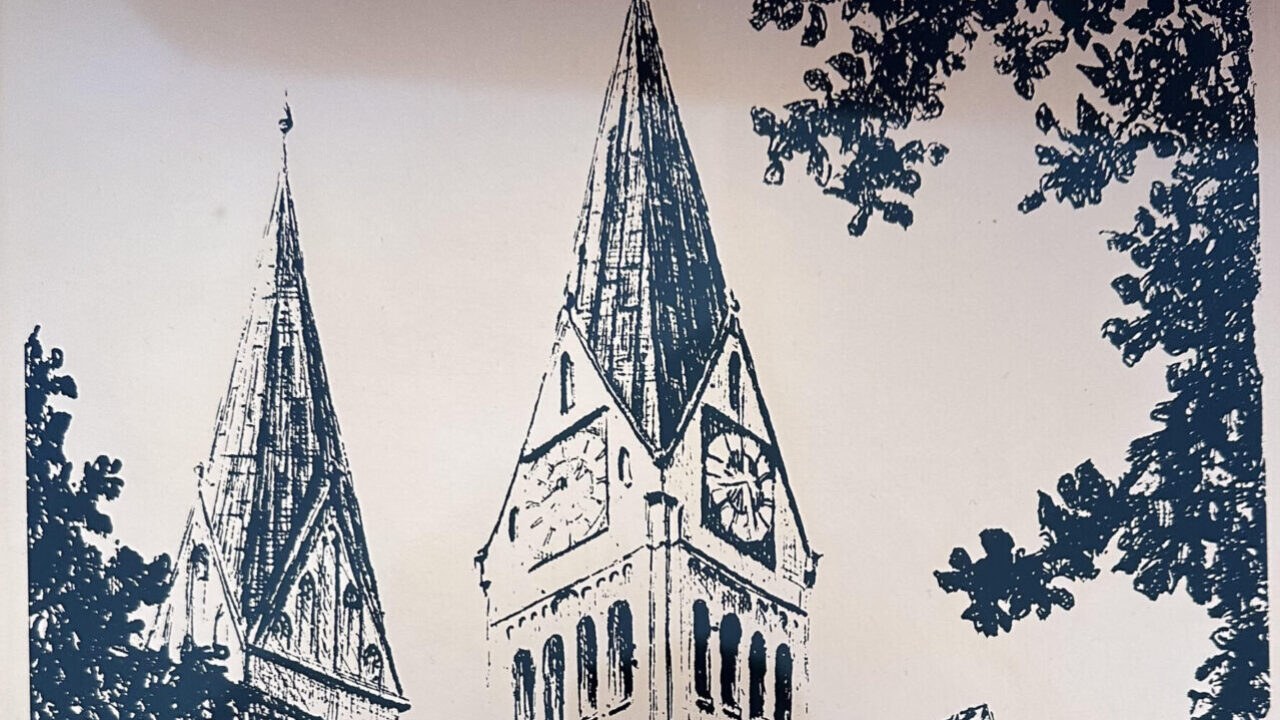Die „brüderliche Zurechtweisung“, die sogenannte „correctio fraterna“, gehört zur geistlichen Tradition des Christentums. Gemeint ist das gegenseitige Sich-Aufmerksam-Machen auf Fehler und Sünden auf dem gemeinsamen Weg zur Heiligkeit. Die Pflicht oder das Gebot, wie es Thomas von Aquin sagt, anderen Mitbruder zurechtzuweisen, muss immer aus Liebe und Barmherzigkeit hervorgehen, sonst läuft man der Gefahr wie Hochmut, falsche Verdächtigung, Neid, Vorurteile, Heuchelei und Groll. Obwohl sich die Kirche dieser Gefahren bewusst war, hat sie doch bis heute an der Pflicht zur „correctio fraterna“, der brüderlichen Zurechtweisung, festgehalten. Im Matthäusevangelium lesen wir die Worte Jesu: „Wenn dein Bruder gegen dich sündigt, dann geh und weise ihn unter vier Augen zurecht! Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Hört er aber nicht auf dich, dann nimm einen oder zwei mit dir, damit die ganze Sache durch die Aussage von zwei oder drei Zeugen entschieden werde. Hört er auch auf sie nicht, dann sag es der Gemeinde! Hört er aber auch auf die Gemeinde nicht, dann sei er für dich wie ein Heide oder ein Zöllner“ (Mt 18,15-17).
In einer Pfarrei, in einem Kloster, in einer Familie, in einem Priesterseminar wie unseres können diesbezüglich viele Fragen entstehen, wie z.B.:
Darf ich jemanden auf sein Fehlverhalten aufmerksam machen? Wenn ja, unter welchen Umständen, zu welcher Zeit und am welchen Ort? Oder soll ich gar nichts sagen, denn es bringt sowie nichts und macht nur Ärger? Was ist dann das goldene Maß zwischen einem geistlichen Spion, der nur Ausschau hält, um andere zu ertappen und einem passiven Mitläufer, dem das Heil seines Mitbruders egal ist und aus dem egoistischen geistlichen Perfektionismus trägt er Sorge nur für sich selbst.
Die oberste Regel der brüderlichen Zurechtweisung ist also die Liebe. Dieses Prinzip war auch bei den Kirchenvätern die höchste Priorität. So nimmt Chrysostomus in einer seiner Homilien Bezug auf das Metapher in 1 Kor 12, christliche Gemeinde sei der geistliche Leib Christi, indem er sagt: „Rührt dich nun das nicht, wenn ich sage, du sollst dich um dein krankes Glied kümmern, […]; so erinnere ich dich an den Leib Christi. Ist es nicht abstoßend, daß du dein eigenes Fleisch faulen siehst und nicht darauf achtest? […] Wegen der Unmenschlichkeit und Nachlässigkeit geht alles so verkehrt durcheinander. […] Gehe hin zu dem Bruder, der [in der Sünde lebt], lobe ihn wegen seiner andern guten Eigenschaften, und erweiche, wie mit warmem Wasser, so durch Lobsprüche seine schwellende Wunde; nenne dich selbst einen armseligen Menschen, klage über das gemeinschaftliche Los des Menschengeschlechtes; sage, daß wir alle Sünder seien: bitte ihn um Vergebung, daß du Etwas gewagt hast, was über deine Kräfte gehe, aber die Liebe dränge ja, alles zu wagen. Allein tue das nicht als Befehl, sondern nur als Rat. Und wenn du dadurch Geschwür niedergeschlagen und den Schmerz, der durch den beabsichtigten Schnitt eintreten wird, gelindert und dich vielfach entschuldigt, und ihn vielmal gebeten hast, er möge nicht zürnen: dann erst, […] wage den Schnitt; weder zu tief, damit er nicht weglaufe, noch zu mild, damit er die Sache nicht als geringfügig ansehe. […]Nichts vorschreiben, sondern nur erinnern.“[1]
Für Chrysostomus war auch klar, dass correctio fraterna nicht nur ein Verständnis, Wohlwollen, sondern auch Empörung, Verstocktheit und noch Schlimmer-Werden hervorrufen kann, darum gibt er seinen Zuhörern und auch uns heute folgende Worte auf den Weg: „Einen anderen zurechtzuweisen wegen Gott ist gut, wobei man sehen muss, ob hieraus nicht ein anderes Übel entstehe. […]Wenn aber daraus ein Nachteil entsteht, der größer ist als der Gewinn, so müssen wir uns wohl hüten, zahllose Seelen zu ärgern, während wir eine einzige trösten.“[2]
Im gleichen Sinne betont Thomas von Aquin, dass die Zurechtweisung nur dann unternommen werden kann, wenn sie dem Besseren dient, sie soll lieber unterlassen, wenn vernünftigerweise vorausgesetzt werden kann, der schuldige werde noch schlechter werden. Denn das Zweckdienliche muß sich dem Zwecke unterordnen. Ist die brüderliche Zurechtweisung ein Hindernis für den Zweck, also für die Besserung, so hat sie nicht mehr den Charakter des Zweckdienlichen und ist somit nichts Gutes mehr.[3]
Der hl. Gregor von Nazianz beobachtet seinerzeit zwischenmenschliche Beziehungen und als ein guter Psychologe, heute würde man das so sagen, bringt er in seinen Überlegungen über die correctio fraterna Folgendes auf den Punkt: „Gleichwie nicht für alle Körper ein und dieselbe Medizin und Kost verordnet wird, sondern bald diese, bald jene, je nach dem Gesundheits- oder Krankheitszustand, so müssen die Seelen […], immer wieder anders belehrt und geleitet werden. Die Kranken beweisen es: die einen werden durch Worte geleitet, andere durch Beispiele bestimmt; die einen bedürfen der Anstöße, andere des Zügels; die Trägen und Schwerfälligen müssen durch scharfe Worte geweckt werden; die aber ungewöhnlich hitzig und schwer zu bändigen sind gleich Pferden, die über das Ziel hinauseilen, werden durch besänftigende und beruhigende Worte gebessert. Lob und Tadel nützen, wenn sie zu rechter Zeit erteilt werden; sie schaden, wenn sie zur unrechten Zeit und ohne Grund erfolgen. Die einen richtet Ermunterung, die anderen Tadel zurecht und zwar der Tadel bald durch öffentliche, bald durch geheime Zurechtweisung. Die einen wollen nicht auf Warnungen achten, wenn sie unter vier Augen erteilt werden, bekehren sich aber, wenn die Öffentlichkeit kritisiert; andere schämen sich nicht bei öffentlicher Kritik, lassen sich wohl aber etwas sagen, wenn man sie im Geheimen rügt, und vergelten schonende Behandlung mit Gehorsam.“[4]
Des Weiteren verweist der hl. Gregor auf die Gefahr, der z. B. ein Priester laufen kann, wenn er andere zurechtweisen will. Er vergleicht correctio fraterna mit dem Tanzen auf hochgespanntem Seile, ein Tanzen, das auch Folgen haben kann für den Tänzer selbst. Ein Beugen nach rechts, nach links oder eine unscheinbare Neigung nach unten bringt ihn aus dem Gleichgewicht, so dass er keine Sicherheit mehr hat und zum Boden fallen kann. So ähnlich kann es jedem ergehen, es gibt keine 100% Garantie selber nicht gefallen zu sein, selber nicht gesündigt zu haben.
Papst Franziskus greift vermutlich die Ausführungen früherer Kirchenlehrer über die brüderliche Zurechtweisung auf und er wendet sich am 3. November 2021 bei der Generalaudienz an alle, indem der Papst einige Tipps auch uns allen gibt:
- Die oberste Regel der brüderlichen Zurechtweisung ist die Liebe!
Das Wohl der Brüder und Schwestern zu wollen bedeutet oft auch die Probleme und Schwächen der anderen zu ertragen, in Stille und Gebet auszuharren, um erst dann den richtigen Weg zu suchen. Das sei nicht einfach anderen Menschen, so wie sie sind, zu lieben, leichter ist vielmehr zu verurteilen, zu schwätzen und üble Nachreden zu verbreiten. „Den anderen schlechtzumachen – als ob ich perfekt wäre! Das sollte man nicht tun. Sanftmut, Geduld, Gebet, Nähe.
- Zuerst über die eigene Schwäche nachdenken
Einem gläubigen Menschen müsse das Wahrnehmen der Sünden anderer Anlass zur Selbsterforschung sein. „Wenn wir nämlich versucht sind, andere zu verurteilen, was oft der Fall ist, müssen wir zuerst über unsere eigene Schwäche nachdenken. Wie leicht ist es, die anderen zu kritisieren. Es gibt Leute, die scheinen einen Hochschulabschluss in übler Nachrede zu haben. Jeden Tag kritisieren sie die anderen. Schau lieber mal auf dich selbst!“
- Was bewegt uns zur brüderlichen Zurechtweisung?
Franziskus rät ausdrücklich dazu, sich immer selbst zu fragen, „was uns dazu bewegt, einen Bruder oder eine Schwester zu korrigieren, und ob wir nicht in gewisser Weise für ihren Fehler mitverantwortlich sind“. Der Heilige Geist schenke „nicht nur die Gabe der Sanftmut, sondern lädt uns auch zur Solidarität ein, um die Lasten der anderen zu tragen.“Auch wir alle können der Versuchung der Überheblichkeit ausgesetzt sein. Nach dem Motto, ich bin wichtig, ich bin ein Priesterkandidat, der im Ausland studiert, ich werde vielleicht sogar ein Bischof. Mit derartigen Gedanken hebt sich die Nase und somit der Kopf immer höher und höher, aber genau in dem Augenblick ist die Gefahr enorm hoch, selber zu stolpern und zu fallen. Amen.
[1] Joh. Chrys. Homilie 44, IV, in: https://bkv.unifr.ch/de/works/252/versions/273/divisions/79239
[2] Ebd.
[3] Vgl. Thomas v. Aquin, Quaestio 33, III, VI, in: https://bkv.unifr.ch/de/works/8/versions/811/divisions/170609
[4] Gregor von Nazianz, Rede II, 30-34, in: https://bkv.unifr.ch/de/works/144/versions/163/divisions/90396