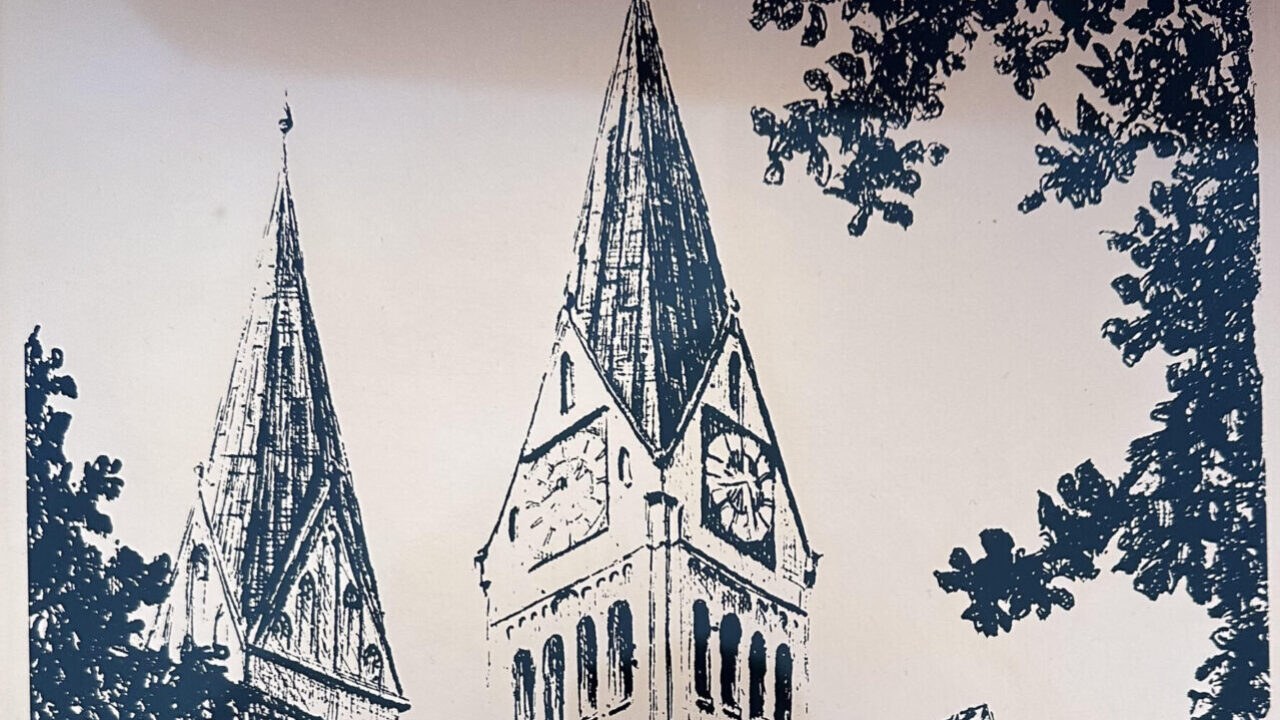Wenn in unseren Ohren der Name Judas erklingt, löst dies bei uns automatisch Ablehnung und Verurteilung aus. Es ist eine Reaktion, nicht so sehr auf den Namen selbst, sondern auf die Person des Jüngers Christi, Judas. Denn der Name selbst genoss im Judentum großen Respekt und Hochachtung. Es war der Name eines der zwölf Söhne Jakobs Judas und bedeutete „Lobpreis“. Nach diesem Judas wurden ein ganzer Stamm und sogar das Königreich Juda benannt.
Der Jünger Christi Judas, stammt vermutlich als einziger von den Zwölf nicht aus Galiläa, sondern aus Judäa und zwar aus der Stadt Kerijot (vgl. Jos 15,25; Am 2,2; etwa 36 km von Jerusalem entfernt), was aus seinem Beinamen Iskariot abzuleiten ist (Mann aus Keriot). Wenn wir die Paulus-Briefe in den Blick nehmen, in denen er auf Judas bzw. seine Tat eingeht, wird hier das Wort παραδίdonai verwendet, das allgemein „ausliefern, dahingeben“ bedeutet und auf den Tod Jesu bezogen ist. Darunter ist auch die Hingabe Jesu durch Gott zu verstehen (Röm 4,25; 8,32) oder die Selbsthingabe Jesu (Gal 2,20; Eph 5,2.25).
Nach dem Markusevangelium besteht neben der Kreuzesnachfolge eine weitere Aufgabe der Zwölf, nämlich die, immer bei Jesus zu sein, in einer tiefen Gemeinschaft mit ihm zu verweilen (vgl. 3,14). Wenn Judas aber mit der Absicht zu den Hohenpriestern geht (Mk 14,10), um Jesus auszuliefern, trennt er sich von seinem Meister; damit entsteht ein Riss in dieser Gemeinschaft, aber keine fatale Trennung, denn er wird immer noch als einer der Zwölf identifiziert (Mk 14,43). Auch nach der Auslieferung Jesu bestand für Judas eine Chance umzukehren und ähnlich wie Petrus seine Tat zu bereuen. Wahrhafte Reue zu empfinden, nicht aber eine Reue, die in der Verzweiflung endet, sondern in Gottes Barmherzigkeit und Liebe.
Die Worte Jesu „einer unter Euch wird mich ausliefern“ (Mk 14,18) und die Frage der Zwölf „Bin
etwa ich es?“ fordern auch uns und die Christen aller Generationen auf, stets darauf zu achten, ob möglicherweise unser eigenes Verhalten, auch ungewollt, fatale Folgen für andere nach sich ziehen könnte.
Das Verhalten des Judas hatte nämlich Folgen, sowohl für die weiteren Ereignisse um Jesus, als auch für ihn selbst. Der Judaskuss spielt auf das Motiv in 2 Sam 20,9f an. Ein Kuss, der das Leiden und den Tod Jesu in Gang setzt. Der übliche Begrüßungsgestus wird zum Verratsgestus.
Während bei Markus dem Judas für seine Leistung nur Geld versprochen wurde, nennt Matthäus den genauen Betrag, nämlich „30 Silberlinge“. Soviel wollen die Oberen Israels für den Bruch mit Samaria ausgeben (Zach 11,12f); so viel, wie der Besitzer eines Ochsen zahlen muss, wenn durch das Tier ein fremder Sklave zu Tode kommt (Ex 21,32). Wie Markus sieht auch Matthäus die persönliche Schuld des Judas, aber auch allgemein die Möglichkeit des Versagens aller Jünger bzw. aller Christen: Das Bekenntnis zu Christus garantiert keineswegs die ewige Seligkeit (Mt 7,21-23). Matthäus zufolge bereut Judas seine Tat, wirft das Geld in den Tempel und erhängt sich. Historisch lässt sich diese Szenenfolge nicht verifizieren, immerhin berichtet die Apostelgeschichte von einem Unfalltod des Judas (Apg 1,18; vgl. Weish 4,19) zu einem späteren Zeitpunkt, und zwar auf dem Grundstück, das er sich von seinem Lohn gekauft hat.
Vom Lukas- und Johannesevangelium erfahren wir, dass Judas bei seiner Tat vom Teufel beeinflusst war. Gemeint ist aber nicht, dass Judas deshalb für seine Tat nicht verantwortlich gewesen wäre. Der Teufel kann nur über den Menschen Macht gewinnen, der sich der Neigung zum Bösen von sich aus hingibt. Der Teufel holt sich also seine „Werkzeuge“ aus dem innersten Kreis der Gemeinschaft Jesu, aus seinen Jüngern. Dass er ins Herz des Judas bereits die Idee gelegt hat, Jesus auszuliefern, weiß Christus längst im Voraus, aber er verhindert es nicht (Joh 13,1f.).
Jesus weiß, wer der Verräter ist (Joh 13,11), der sich nicht nur an ihm, sondern an der Gemeinschaft der Jünger vergangen hat (Joh 13,17f.), trotzdem reicht er ihm das Brot (Joh 13,27).
Am Fall des Judas können wir eine andere Lebensgeschichte erkennen, eine, die im Gegensatz zu der der anderen Apostel, besonders zu der von Simon Petrus, in Enttäuschung ihr Ende findet. Fehler und Scheitern gehören zum Leben eines jeden von uns. Aber es gibt keinen menschlichen Fehler und kein Scheitern, dass Gott unbekannt bliebe. Jeder Gescheiterte und jeder, der gefehlt hat, kann Gott oder Menschen um Vergebung bitten. Nach bitteren Tränen und in dem Vertrauen auf Gottes Barmherzigkeit, erhält Petrus Vergebung für seine dreimalige Verleumdung. Judas hat seine Tat ebenfalls bereut, aber es war eine Reue in Verzweiflung; er wandte sich von Gott ab und glaubte nicht an die allverzeihende Vollmacht Gottes. Gott achtet auf die innere Freiheit eines jeden von uns, auch auf die des Judas. Weil Gott uns Vernunft und freien Willen geschenkt hat, wird er uns niemals zwingen, umzukehren oder uns an ihn zu wenden. Das ist unsere freie Entscheidung. Die Türklinke ist auf unserer Seite und es hängt nur von uns ab, ob wir die Tür aufmachen, uns für Gott öffnen, oder uns verschließen. Er aber bleibt treu (vgl. 2 Tim 2,13f.) und wartet geduldig auf unsere Entscheidung (vgl. Offb 3,20). Wir verraten Jesus vielmals am Tag durch unsere kleineren oder größeren Sünden, unsere Untreue, unsere Aufenthalte weit weg von ihm, „in einem fremden Land“; trotzdem hat er uns lieb, denn wir sind seine Geschöpfe, seine Kinder; er wird uns immer verzeihen, auch dann, wenn es nach menschlichen Ermessen unmöglich ist.
Mögen die Lebensgeschichten der zwölf Apostel Christi uns, die wir auch seine Apostel sein wollen, zum Nachdenken bringen und unser geistliches Leben prägen. Amen.