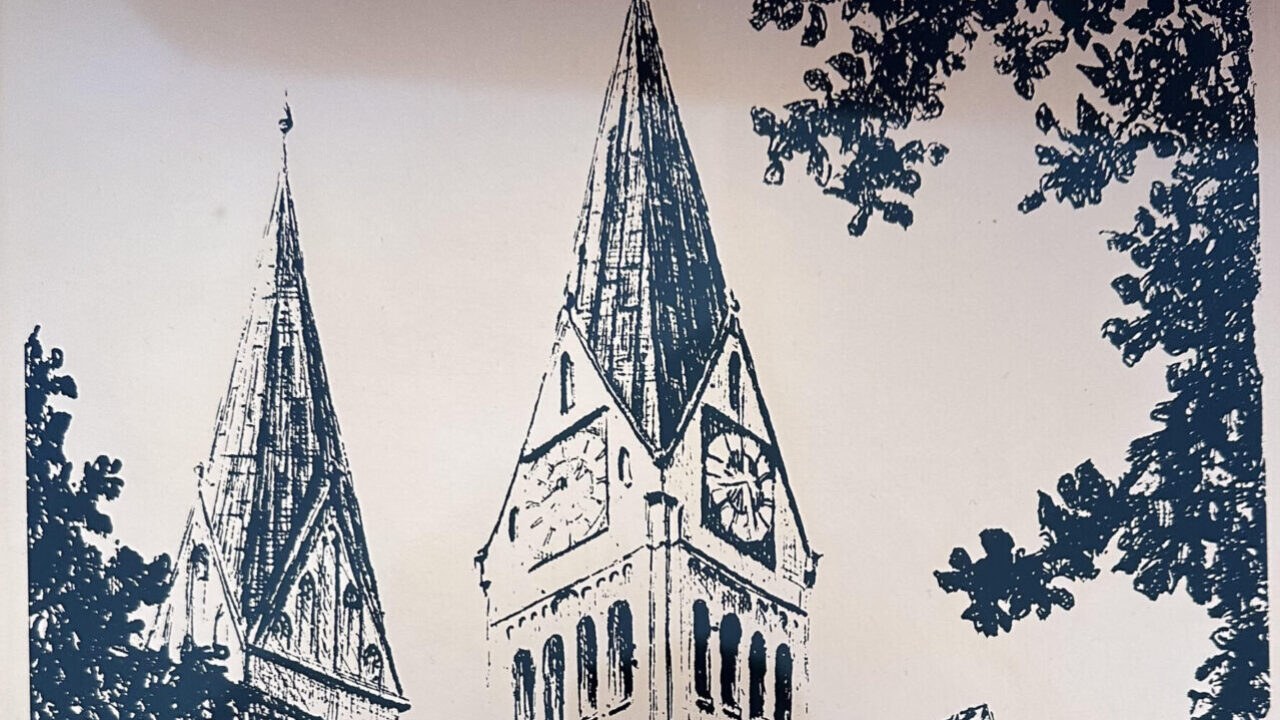„Der größte Traum Gottes für uns Menschen ist, dass wir leben, dass wir leben in Fülle haben“ sagte P. Michel Van Parys OSB aus Chevetogne bei den Exerzitien im Jahre 2023 im Collegium Orientale. Zum Leben gehört nicht nur das physische, in dem wir atmen, essen, schlafen und unseren Bedürfnissen gerecht werden versuchen. Zum Leben, ja, zum erfüllten Leben gehören auch wichtige Fragen unseres Daseins und unseres Auftrags hier auf dieser Erde, hier im Collegium, hier an der Universität. Die Frage nach dem Sein und Auftrag des Priesters wurde zu einem »Seismographen« für die vielfältige innere Unruhe, die mit den Umbrüchen und Entwicklungen in der Kirche, aber auch mit der Frage nach der Identität der Kirche in unserer Welt von heute aufs engste verbunden ist. So ist es gut und notwendig zu Beginn des Sommersemesters 2023 einige Grunddaten zum Selbstverständnis und Dienst des Priesters in Erinnerung zu rufen.
Das Amt in der Kirche besitzt einen völlig anderen Charakter als ein Amt in der Gesellschaft und Politik. Wohl wurde und wird es zuweilen in struktureller Ähnlichkeit zu einem weltlichen Amt gesehen: Man diskutiert über die Funktion der Gemeindeleitung, darüber, was ein Priester zu sagen hat und was er bzw. die Laien tun können, was der Priester an sie abzutreten hat und was nicht. Negativ könnte dies heißen, dass es nicht zum geistlichen Amt gehört, den organisatorischen Betrieb einer Pfarrei zu managen, Finanzen zu verwalten, Bauarbeiten zu tätigen, kirchliche Institutionen wie Kindergarten, Pflegestationen und dergleichen zu verwalten: das alles wird mancher Laie gut und gerne tun, vielleicht sogar besser als ein Priester. Gefragt wird vor allem nach der Sinnhaftigkeit des Amtes und der Hierarchie und nach der Möglichkeit ihrer Neudefinition.
Das Priesteramt entfaltet sich aus den drei christologischen Titeln des Lehrers, des Priesters und des Königs (PO 1), und zwar als Verkündigung, Sakramentenspendung und Gemeindeleitung. Die nachtridentinische Deutung des Priesteramtes beschränkte sich in der lateinischen Kirche vor allem auf die Sakramentenspendung und ihre sakralen Handlungen, hingegen trat das Missionarische eher in den Hintergrund, bis das II. Vatikanum erneut die missionarische Tätigkeit als Echtheitskriterium priesterlichen Dienstes hervorhob. Denn der Priester ist primär nicht Vorsteher einer liturgischen Versammlung, vielmehr dient er – wie der Bischof – zunächst und vor allem der Verkündigung des Evangeliums. Diesem Dienst bleiben die Feier der Liturgie und die dem Priester entsprechende Leitungsgewalt untergeordnet. Ist es die primäre Aufgabe des Bischofs, das Evangelium zu verkünden, so auch die des Priesters, der an der Aufgabe des Bischofs teilhat. Deshalb entscheidet sich die Glaubwürdigkeit von Dienst und Lebensweise des Priesters zunächst am Dienst der Verkündigung.
Unter dem Wirken des Heiligen Geistes wird aus dem Dienst ein Amt und aus dem Amt ein Dienst. Dieser setzt zwar Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten voraus, die zu erlernen, zu entfalten und immer anzueignen sind. Dennoch wäre einer, der alle diese Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse vorweisen und sie sachgerecht anwenden könnte, noch kein authentischer Priester. Was ihn zum Priester macht, ist seine apostolische Sendung, die ihm im Sakrament der Priesterweihe verliehen wird. Der eigentliche »Bauherr« priesterlicher Existenz und priesterlichen Dienstes ist und bleibt einzig und allein der dreieine Gott.
Das bedeutet: Die Legitimation des Amtes kommt weder aus der Gemeinde noch durch eigene erworbene Kompetenz, sondern dadurch, dass in der Weihe Christus selbst einen Menschen in Anspruch nimmt, damit seine, nämlich Gottes Wirklichkeit im sakramentalen Tun, im Wort und im Dienst zum Ausdruck gebracht, »dargestellt« wird. Diener Christi sein heißt: Zeichen bzw. »Ikone« sein und Zeichen setzen für den gegenwärtigen und unmittelbar wirkenden Herrn, damit die Gemeinde sich ihm und seinem Wirken öffnet. So ist das amtliche Tun Dienst für Christus und in ihm Dienst an den Menschen.
Die Gabe der Berufung zum priesterlichen Dienst muss vom Einzelnen in Freiheit angenommen werden und in seinem Leben eine authentische Gestalt gewinnen, vor allem in einem geistlichen Leben und auf einem gesamtmenschlichen Reifungsweg. Auch dies wird sich vor allem unter dem Beistand des Heiligen Geistes vollziehen.
Er lehrt den Priester vor allem, Christus nicht mehr als Individuum, sondern als die »Vielen« zu betrachten, die zu dem einen »Leib« aus vielen Gliedern gehören: Die Kirche ist »Leib Christi«, weil sie zugleich »Tempel des Heiligen Geistes« ist, der die Vielen im Leib Christi eint. Schon der Apostel Paulus verband den Begriff der »koinonia« (communio), d.h. der Gemeinschaft im Glauben, unmittelbar mit dem Heiligen Geist und seinem Wirken. Sein Werk ist es auch, dass der Priester in seinem Dienst je nach seinem Charisma und seiner Berufung zu wirken vermag, doch auch dies wird sich immer in Gemeinschaft mit seinen Brüdern und Schwestern vollziehen, in deren Dienst er sich bestellt sieht (vgl. Hebr 5,1).
In Lumen Gentium 4 heißt es in Anlehnung an Cyprian, Augustinus und Johannes von Damaskus: »So erscheint die ganze Kirche als ‘das von der Einheit des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes her geeinte Volk’.«[1] Auch das Priesterdekret des II. Vatikanum sieht das Sein und Wirken des Priesters in einem trinitarischen Kontext, obgleich das Konzil diesen Aspekt nicht weiter entfaltet: Die Priester »nehmen teil an dessen [Christi] Amt, durch das die Kirche hier auf Erden ununterbrochen zum Volk Gottes, zum Leib Christi und zum Tempel des Heiligen Geistes auferbaut wird«[2]. Als Volk Gottes des Vaters ist die Kirche die Versammlung aller zum Glauben Berufenen, welche durch die gemeinsame Würde und Sendung verbunden ist. Sodann ist sie Leib Christi, der das Haupt seines Leibes ist und den ganzen Leib durch sein Evangelium, seine Sakramente und den Dienst, der zum Apostel- und Hirtenamt Berufenen zusammenfügt. Schließlich ist sie Tempel des Heiligen Geistes, der in den Vielen je nach seiner Gabe wirkt und Gemeinschaft in der Vielfalt schafft. Diesem Dienst an der Einheit wird sich jeder Priester verpflichtet wissen. Die trinitarische Grundlegung des priesterlichen Dienstes wie auch der ganzen Eucharistiefeier ist für das östliche Liturgie- und Amtsverständnis grundlegend, wie in den trinitarisch ausgerichteten Gebetsabschlüssen sichtbar wird.
Obwohl ein Priester von Gott berufen und gesandt wird und durch das Gebet und die Handauflegung des Bischofs bevollmächtigt wird, bleibt er trotzdem ein Mensch, also kein Engel auf Erden, sondern ein Mensch in seiner Schwachheit und Unvollkommenheit. Und wiederum sagte P. Michel, dass heutzutage sehr gerne über die Vergöttlichung bzw. über das Herzensgebet gesprochen wird, dabei wäre es zunächst viel nützlicher über das Menschsein und seine von Gott gegebene Würde zu sprechen, denn ohne nüchternes und gesundes Verständnis von Menschsein ist die Vergöttlichung nicht möglich.
Also zu Existenz und Identität des Priesters gehört unmittelbar das Wissen über das eigene Menschsein. Nicht nur die Kirche als Gemeinschaft der Glaubenden wird als Tempel des Heiligen Geistes bezeichnet, sondern jeder einzelne kann sich als Tempel Gottes verstehen. Ist der gläubige Mensch doch dazu erwählt und mit Myron gesalbt, ein Tempel des lebendigen Gottes zu sein (2 Kor 6,16), wie der Herr verheißen hat: „Wer mich liebt, der wird mein Wort halten; und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen“ (Joh 14,23). Mit dieser Verheißung ist schon jetzt die Endzeit angebrochen. Psalm 68,36 (LXX 67,36) lautet aus dem Hebräischen übersetzt: „Furchtbar ist Gott von seinem Heiligtum aus“ und wird in diesem Wortlaut werktags vor dem Kleinen Einzug gesungen. Die Septuaginta übersetzt den Vers mit: „Wunderbar ist Gott in Seinen Heiligen.“ Gemeint ist hier der lebendige Tempel aus den Heiligen, in denen sich Gott als groß und wunderbar erweist. Die Menschen also sind jener Ort, an dem Gott zur Ruhe kommen will – und zwar seit dem siebenten Tag, an dem er mit seiner Sabbat-Ruhe sein Schöpfungswerk gesegnet hat.
Wenn also der Mensch ein Tempel des Heiligen Geistes ist, Wohnstätte Gottes und der Ort seiner Ruhe, muss der Mensch sich doch seiner Tragfähigkeit bewusst werden und dafür dankbar sein. Amen.
[1] H. J. Pottmeyer, Priester für eine sich wandelnde Kirche und Gemeinde. Vortrag am 4. November 1981 im Coll. Borromaeum, Münster.
[2] Ebd.; vgl. Presbyterorum ordinis Nr. 1.