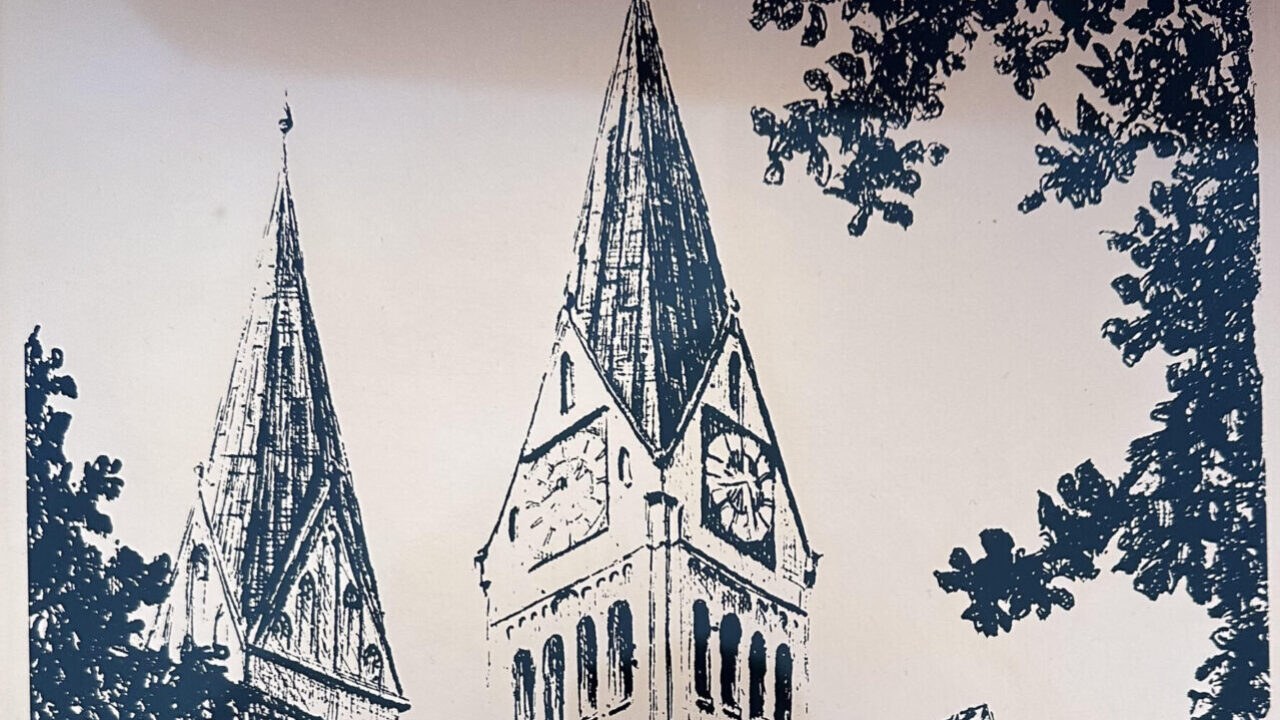Am 6. Mai 2024, genau heute vor 35 Jahren, hielt damals Kardinal Joseph Ratzinger im Priesterseminar zu Würzburg einen Festvortrag anlässlich dessen 400. Jahrestages seiner Gründung. In Bezug auf die Perspektiven der Priesterausbildung stellte er fest, dass die Aufgabe des Seminars mehr sein muss als nur eine Ausbildung zum Priesteramt. Sie sollte gleichzeitig die „Bildung zum rechten Menschsein“ beinhalten welche in erster Linie eine Herzensbildung ist. Denn zu den Eigenschaften eines angehenden Geistlichen gehören Gemeinschaftsfähigkeit, Großzügigkeit, Geduld, Vertrauen, Klugheit, Diskretion und Empathie sowie eine gute Portion Frustrationstoleranz. Es bedarf nach Joseph Ratzinger der „Erziehung zur Wahrheit“. Denn die Wahrheit ist Jesus Christus selbst. Wo diese geistliche Mitte fehlt und das Mühen um die Wahrheit vernachlässigt wird, sinkt das Seminar herab zum schlichten „Nebeneinander von Studentenzimmern“. Ohne die Suche nach Wahrheit, nach Christus, und ohne die Sehnsucht nach Liebe in Christus wird das Priesterseminar zu einem Studentenwohnheim. Auf diese Weise kreist der Gedanke des späteren Papstes um unser heutiges Thema „Liebe vor und nach der Weihe“. Woran lässt sich erkennen, ob die Liebe zur eigenen Berufung einen Menschen erfüllt? Kann man die Liebe festhalten, oder ist sie immer einem Veränderungsprozess unterworfen? Und schließlich, ist es möglich, der Gefahr einer „Liebeskrise“ zu entgehen?
Um diese Fragen beantworten zu können, werden im Folgenden drei Punkte betrachtet: Erstens werfen wir einen Blick auf die Bibel und die Beziehung zwischen Jahwe und dem Volk Israel. Zweitens untersuchen wir die Weihegebete der byzantinischen und syrischen Tradition. Im dritten Punkt versuchen wir schließlich, einige Tipps für die Praxis im Priesterleben zu geben.
„Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das größte und erste Gebot. Ein zweites aber ist ihm gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.“ (Mt 22,37-39; vgl. Mk 12,30f). Jesus zitiert das wichtigste Gebot aus dem Buch Deuteronomium, einem Buch, das nach dem Buch Hosea und dem Hohenlied, als biblisches Buch der Liebe Gottes zu Israel bezeichnet werden kann. „Höre, Israel! Der HERR, unser Gott, der HERR ist einzig. Darum sollst du den HERRN, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Und diese Worte, auf die ich dich heute verpflichte, sollen auf deinem Herzen geschrieben stehen. Du sollst sie deinen Kindern wiederholen. Du sollst sie sprechen, wenn du zu Hause sitzt und wenn du auf der Straße gehst, wenn du dich schlafen legst und wenn du aufstehst.“ (5 Mose 6,4-7)
Das Liebesgebot im Deuteronomium hat seine Wurzeln im damaligen internationalen Staatsrecht.[1] In der alten Welt wurden Staaten nicht als abstrakte Konzepte betrachtet, sondern als persönliche Beziehungen zwischen dem einzelnen und dem Herrscher. Diese Beziehungen wurden oft als „Liebe“ proklamiert, obwohl es eher um Macht und Versklavung ging. Das Deuteronomium übernahm diese Vorstellung und übertrug sie auf die religiöse Beziehung zu Gott, insbesondere zu Jahwe als dem „Großkönig“ Israels, der sein Volk aus der Sklaverei herausführt und sein Volk bedingungslos liebt. Wie der Gott des Alten Testaments lieben kann, zeigt sich beispielhaft am Propheten Hosea, der seine Frau Gomer liebt und ihr das ganze Leben treu bleibt, trotz ihrer Fehler und ihrer Untreue. Wie Gott uns, Menschen lieben kann, zeigt sich auch an seinem Sohn, Jesus Christus, der die Seinen liebte, bis ans Kreuz. Auch im priesterlichen Dienst zeigt sich die Liebe durch die Treue, nämlich im alltäglichen Arbeiten und Ausharren, öfters in dankbarer Sehnsucht nach dem unverwelkten Kranz der Herrlichkeit Gottes. „Der Herr ist treu; er wird euch Kraft geben und euch vor dem Bösen bewahren“ ermutigt der hl. Apostel Paulus die Christen in Thessaloniki. […] Der Herr richte eure Herzen auf die Liebe Gottes aus und auf die Geduld Christi.“ (2 Thess 3,3-5). „Nie sollen Liebe und Treue dich verlassen; binde sie dir um den Hals, schreib sie auf die Tafel deines Herzens!“ (Sp 3,3) lesen wir im Buch der Sprüche, fast im Einklang mit dem Gebet „Schma Israel“. Jahwe ist seinem Bund mit Israel immer treu geblieben, auch in den Zeiten seine Untreue und seine Götzenverehrung. Durch Umkehr und Anerkennung eigener Schwachheit und Fehler schenkte Jahwe dem Volk seinen Segen und Wohlergehen. Der gleichen Logik folgend finden wir ein weiterer Beweis dafür im 2. Timotheus: „Wenn wir untreu sind, bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen.“ (2 Tim 2,13). Mit anderen Worten: Wenn wir unsere Sünden bereuen und bekennen, können wir darauf vertrauen, dass Gott treu ist und seine Verheißung erfüllt: Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Bösen (1 Joh 1,9).
Liebe Kollegiaten! Damit es nicht nur theoretisch bleibt, möchten wir in aller Kürze einen Blick auf die Weihegebete werfen, sowohl im byzantinischen als auch im syrischen Ritus. Bei der Priesterweihe legt der Bischof seine Hände auf das Haupt des Kandidaten auf und betet, „die göttliche Gnade heilt immerdar alle, die schwach sind und ergänzt alles, an was es ihnen mangelt. Deshalb erflehen wir für den zu Weihenden das Herabkommen der Gnade des allheiligen Geistes.“ Das zweite Gebet bezieht sich auf den zukünftigen Lebensentwurf des Priesters, in untadeligem Leben und festem Glauben große Gnade des Heiligen Geistes zu empfangen. „Mach, Herr, deinen Diener vollkommen, auf das er Dir in allen Dingen wohlgefalle und schenke ihm ein würdiges Leben, entsprechend der ihm verliehenen großen priesterlichen Ehre“. Die Verwendung des Imperativs „mach“ und der Ausdruck „in allen Dingen Dir wohlgefalle“, soll zeigen, dass kein Mensch vollkommen ist und, dass man Gott wohlgefällt, indem man ihn liebt, an Ihm Freude hat, und ihm treu bleibt, denn sonst kann man Gott nicht gefallen. Der weitere Imperativ im dritten Gebet „erfülle, o Herr, auch diesen Deinen Diener mit den Gaben Deines Heiligen Geistes“ rüstet den Kandidaten für die folgenden Aufgaben. Erstens: untadelig vor dem Opferaltar zu stehen, und sich selbst opfern zu lassen. Zweitens: das Evangelium zu verkünden. Drittens: das Wort der Wahrheit als Priester zu verwalten, was bedeutet ,in der Wahrheit Christi und in Gerechtigkeit in jeder Lebenssituation zu handeln. Viertens: geistliche Gaben und Opfer darzubringen, was heißt, zu beten und die hl. Eucharistie zu feiern, dankend für alles. Fünftes: das Volk durch das Bad der Wiedergeburt zu erneuern, also durch die Taufe das neue Leben in Christus zu ermöglichen. Durch die Erfüllung dieser fünf Aufgaben in Verbindung mit dem Erbarmen Gottes wird dem Priester, der sein Leben lang als guter Verwalter gedient hat, eine Belohnung versprochen. Um ein guter Verwalter zu sein, bedarf er der Gaben des Hl. Geistes, um die auch gebetet wird und deren er sich das ganze Leben hindurch befleißigen muss. Weisheit, Einsicht, Rat, Stärke, Erkenntnis, Gottesfurcht und Frömmigkeit sind die wichtigsten Gaben des Hl. Geistes.
Auch in der syrische Tradition betet der Bischof bei der Diakonenweihe folgendes Gebet: […] mache deinen Diener, dass er auf deinem heiligen Weg geht, dass er seinen Sinn immer auf die geistlichen Dinge richtet, dass er in der Reinheit der Seele und des Leibes handelt, dass er allezeit die Gebote betrachtet, […] dass er in der wahren Liebe handelt, den Segen des Herrn ständig besingt, auf die Gebote des Evangeliums neugierig ist und seine erhaltenen Talente, gemäß dem Evangelium vermehrt. […] Mache ihn zu einer göttlichen Harfe, die schöne Töne erklingen lässt und dir so dient. Erfülle ihn mit Liebe zu dir, zu seinen Brüdern und zu den Fremden. […] Lass ihn zu einem Diakon werden, der in allem und immer wahrhaftig handelt und Dinge tut und vollendet, die deiner würdig sind und an denen du Wohlgefallen hast. Herr, mögen wir durch die Taten, die deinem Willen wohlgefällig sind, an deiner rechten Seite stehen. Auch dieses Weihegebet spricht am Ende von der ewigen Belohnung, zur Rechten Gottes stehen zu dürfen.
Liebe Kollegiaten! Zusammenfassend lässt sich sagen, dass aus unseren Ausführungen einige Tipps abgeleitet werden können. Dabei ist es wichtig zu bedenken, dass Liebe stets ein veränderlicher Wachstumsprozess ist und dass es keine Garantie gegen Scheitern und Krisen gibt.
- Liebe ist eine göttliche Tugend, um die wir beten sollen, z. B. Herr, lehre mich zu lieben.
- Lieben heißt, sich bemühen, der eigenen Berufung immer treu zu bleiben.
- Lieben heißt, Ehrfurcht zu haben vor Gott – und dem Nächsten, wie auch sich selbst, auf der Grundlage der Würde, Achtung zu erweisen
- Lieben heißt dienen.
- Lieben heißt bewahren.
Möge Gott uns dabei helfen! Amen.
[1] Vgl. Georg Blaulik, Die Liebe zwischen Gott und Israel, in: IKaZ 41 (2012), 549-564.