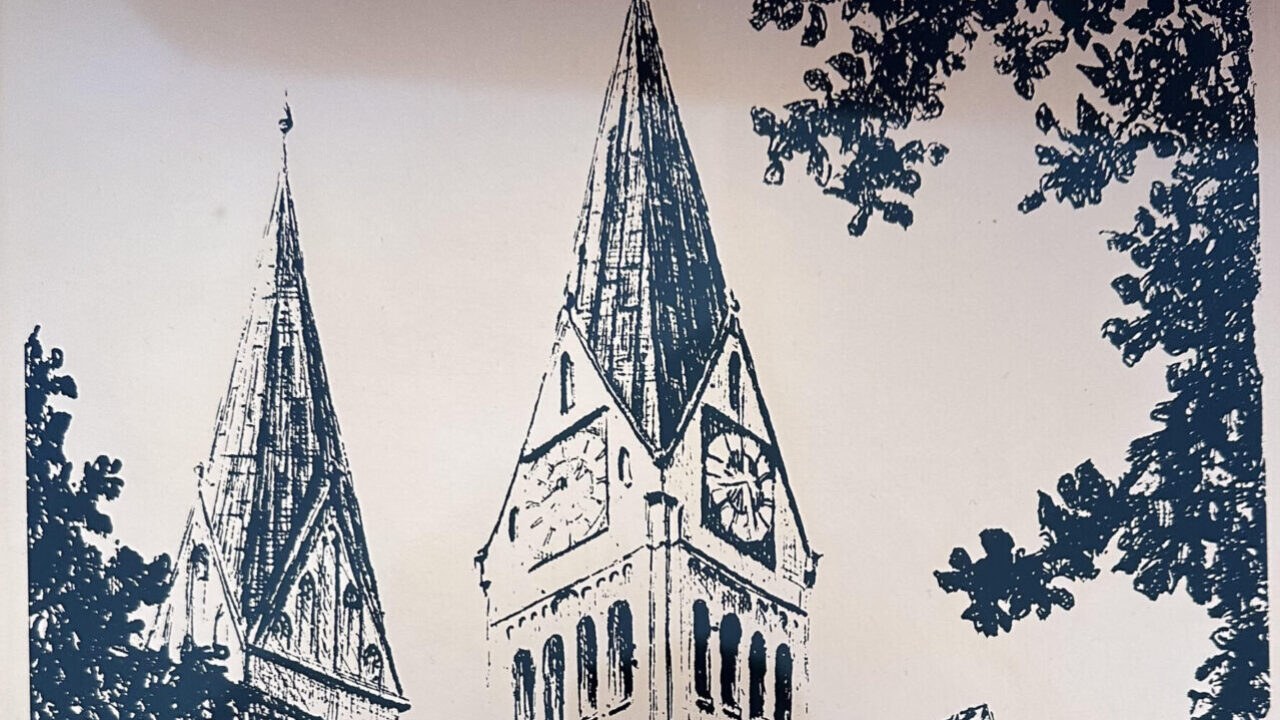Immer wieder erfahren wir im Gebet, dass unsere Gedanken abschweifen; nicht anders verhält es sich auch im Alltag, dass wir uns gleichsam von Gott entfernen und aus seiner Gegenwart heraustreten, meist sogar unabsichtlich. Dann gilt es, erneut zu der Stelle im Gebet zurückzukehren, an der unsere Gedanken abschweiften; und ebenso werden wir uns im Alltag wieder neu in die Gegenwart Gottes stellen an dem Punkt, wo wir den Kontakt mit ihm verloren haben. Anschließend werden wir mit besonderer Aufmerksamkeit die nächsten Schritte unternehmen, um bei Gott bleiben zu können.
Wir bestehen aus Leib und Seele, doch in der Gegenwart Gottes wird durch seine Gnade unsere Natur wieder eins. Dürfen wir dies erfahren, ist es eine besondere Gabe Gottes, denn sie lässt uns »schmecken und sehen, wie gütig der Herr ist« (Ps 34,9), so dass wir erkennen, wonach wir streben wollen und was ein wahres Gebet vor Gott ist.
Die schon angesprochene Absichtslosigkeit als Grundhaltung eines kontemplativen Lebens wird besonders in den Augenblicken des Lebens als eine Herausforderung erfahren, da der Mensch dem Geheimnis seines Lebens begegnet. Jeremias beantwortet die Frage: «Wer vermag das Herz zu erforschen?« mit den Worten: »Gott allein durchforscht Herz und Nieren« (Jer 17,9-10), denn er allein dringt bis zum »verborgenen Menschen des Herzens« (1 Petr 3,4) vor.
Auf Gott hin geschaffen, ist der Mensch dazu berufen, in seinen Lebensvollzügen am Geheimnis Gottes teilzunehmen. Dies bedeutet für den Menschen zunächst eine leidvolle Erfahrung, denn er ist »ein Abbild des unaussprechlichsten trinitarischen Geheimnisses, bis in jene Tiefen hinein, in denen der Mensch für sich selbst ein Rätsel wird«[1]. Gregor von Nyssa führt hierzu aus: »In der Unerkennbarkeit des eigenen Ich erweist sich der Mensch als Abbild des Unaussprechlichen.«[2]
Der göttlichen Apophatik entspricht eine menschliche Apophatik[3], ist es doch »leichter, den Himmel zu erkennen, als dich selbst«[4]. Der Mensch ist größer als alles, was er unmittelbar von sich erkennt. Zur vollen Erkenntnis über sich gelangt er in dem Augenblick, wo er sich in all seinen Vollzügen von Gott her versteht und sein Leben gestaltet. Nikolaus Kabasilas [† 1391] sagt: »Wie eine Schatztruhe ist die Liebe (des Menschen), so groß und so weit, daß sie Gott aufzunehmen vermag […] Das Auge wurde ausschließlich auf das Licht hin geschaffen, der Gehörsinn auf die Töne, und jeder Sinn auf das ihm Gemäße. Das Verlangen der Seele aber geht auf Christus allein und findet in ihm seine Herberge.«[5]
Bei Abt Poimen heißt es: »Befiehl niemals, sondern sei für alle ein Beispiel, aber nie ein Gesetzgeber.«[6] In den Mönchserzählungen wird des Weiteren berichtet: »Ein junger Mönch suchte einst einen alten Asketen auf, um über den Weg der Vollkommenheit belehrt zu werden, aber der Greis sprach kein Wort. Der Besucher befragte ihn über den Grund seines Schweigens. ‚Bin ich etwa ein Oberer, um dir zu befehlen?‘, antwortete er. ‚Nichts werde ich dir sagen. Tu, wenn du willst, was du mich tun siehst.‘ Darauf ahmte der junge Mann in allem den alten Asketen nach und lernte den Sinn des Schweigens und des freien Gehorsams.«[7] Der geistliche Vater und der Schüler stehen beide gemeinsam in der Schule Gottes. Selbst wenn der Vater ein Heiliger wäre, darf er nicht zu einem Idol werden, sondern er muß seine Schüler in Christus mündig werden lassen. »Wer in der Wüste leben will, soll nicht mehr nach Belehrung verlangen; er soll selbst Lehrer werden, sonst müßte er viel leiden.«[8] So geht es mir [dem Spiritual] bei der Einübung eines kontemplativen Lebensstils um keine Weitergabe von Rezepten und Tricks, vielmehr ist der Einzelne aufgerufen, in der Einzigartigkeit seines Wesens selber nach einem überzeugenden Leben aus dem Glauben zu suchen. Zu dieser »Freiheit« des Glaubens ist jeder bei der Gestaltung seines geistlichen Lebens aufgerufen. Amen.
[1] P. Evdokimov, Le Saint Esprit dans la tradition orthodoxe. Paris 1966, 80.
[2] PG 44,155.
[3] Gregor von Nyssa sagt sogar: Wir können nicht einmal das Wesen auch nur des kleinsten Grashalms kennen (Gregor von Nyssa, Contra Eunomium, XII [PG 45,932C-952C]). Nur wer die Welt als Ort Gottes sieht, dem »werden die sichtbaren Dinge mittels der unsichtbaren vertieft«. Nicht anders Thomas von Aquin: »ne muscam quidem«: nicht einmal eine Mücke können wir in ihrem Wesen adäquat erkennen (zit. bei R. Schaeffler, Logisches Widerspruchsverbot und theologisches Paradox. Überlegungen zur Weiterentwicklung der transzendentalen Dialektik, in ThPh 62 [1987] 321-351, hier 333).
[4] Gregor von Nyssa, De opificio hominis (PG 44,257C).
[5] Das Buch vom Leben in Christus des Nikolaos Kabasilas. Übers. von G. Hoch und hrsg. von E. von Ivánka, Klosterneuburg 1958, 80. Broussaleux übersetzt: »Durch Christus ist das Menschenherz geschaffen worden, ein ungeheures Schmuckkästchen, groß genug, um Gott selbst zu fassen. Das Auge ist für das Licht geschaffen, das Ohr für die Töne, alle Dinge für ihren eigenen Zweck, das Sehnen der Seele aber, um sich emporzuschwingen zu Christus.«
[6] PG 65,363.564.
[7] PG 65,224.
[8] Vitae Patrum VII,19,6.