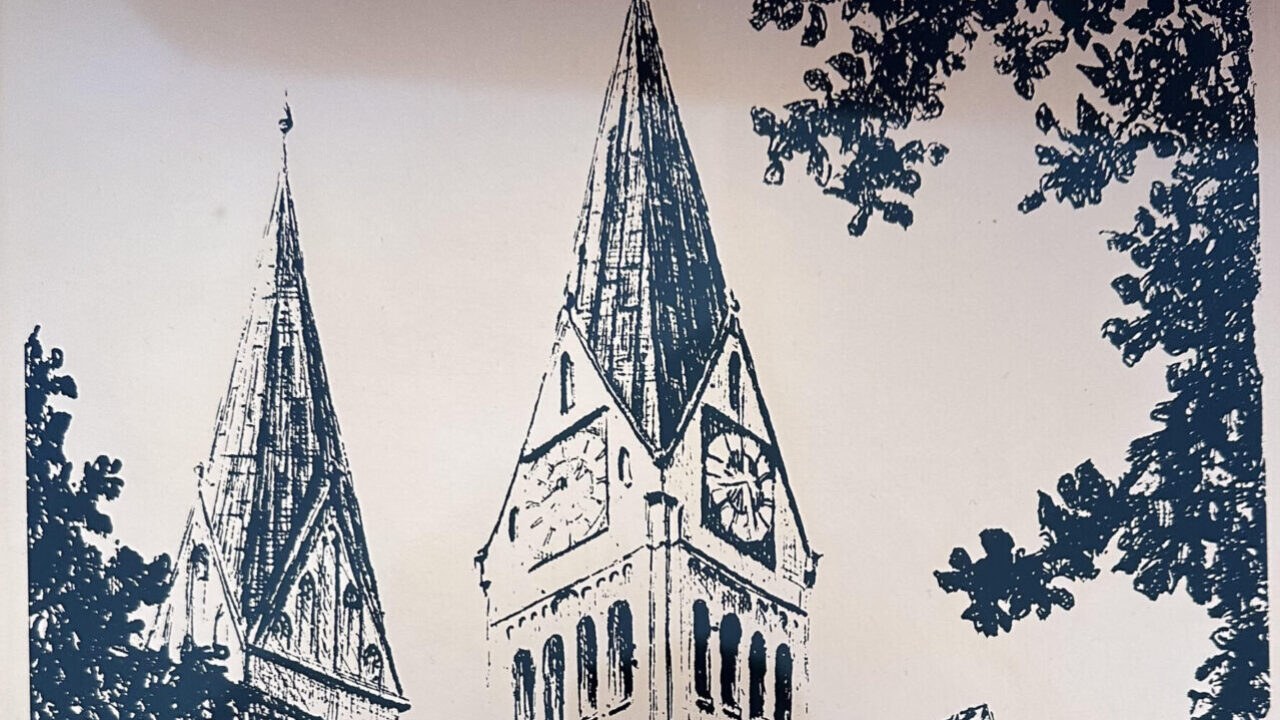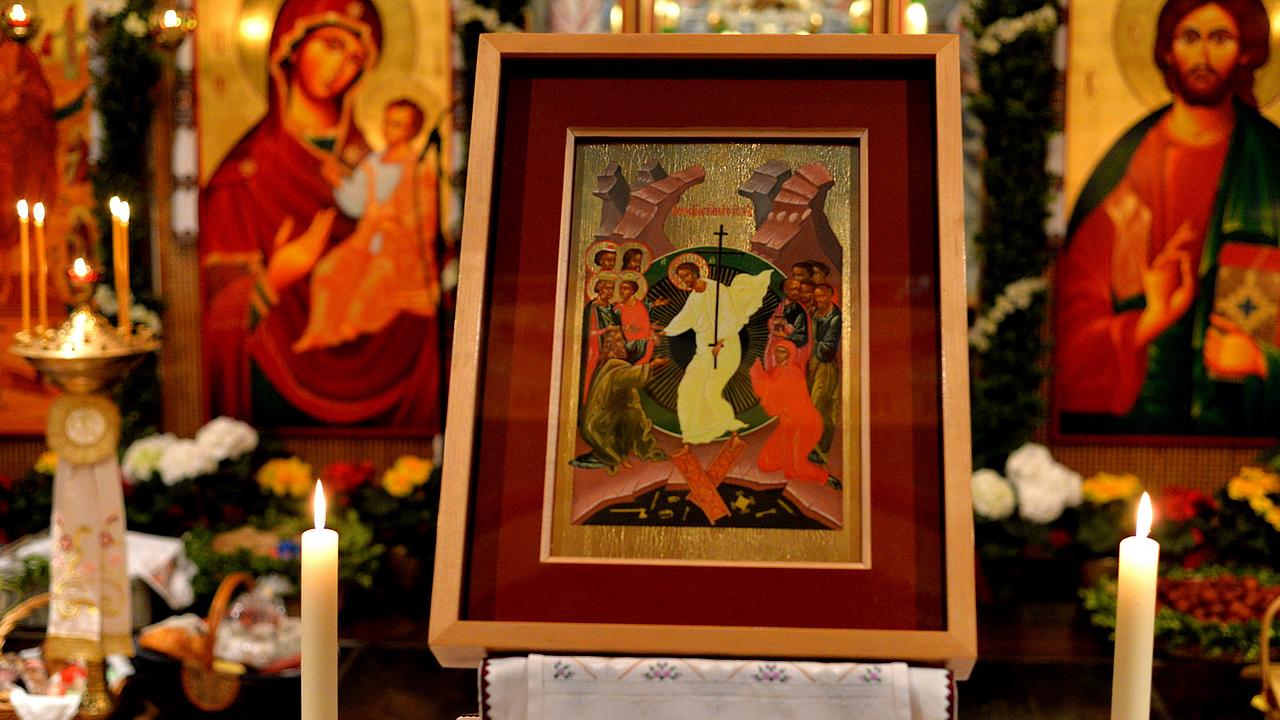
„Für euch bin ich [Priester], mit euch bin ich Christ“ (Aug., serm. 340,1) sagt der Kirchenlehrer hl. Augustinus. Um diesen Gedanken ausformuliert und beherzigt zu haben, hat Augustinus lange Zeit gebraucht. Für ihn war es ein langer Weg bis er den gefunden hat, der sein Herz beruhigte. Wie damals Augustinus sind wir auf dem Weg der Suche oder besser gesagt auf dem Weg zur Heiligung. Und dieser Weg beginnt seit Kindesbeinen und verläuft an verschiedenen Stationen wie Kindergarten, Schule, Universität und nicht zuletzt für die Seminaristen, das Priesterseminar. Das Stichwort „Priesterseminar“ erweckt bei einem vielleicht das Gefühl der Freude, Dankbarkeit und der Gelassenheit. Zeit der menschlichen, intellektuellen, geistlichen und pastoralen Reife, formatio-Zeit. Bei anderem wiederum war oder ist das Leben in einem Priesterseminar eine Zumutung, Zeit ohne Freude und ohne Entwicklung: deformatio-Zeit. Die meisten von euch haben bereits eine Erfahrung in Euren Heimatländern bzw. Seminaren gemacht und diese mit nach Eichstätt gebracht. Das sind ganz verschiedene Erfahrungen: einige waren etwa sechs Jahre in einer Seminargemeinschaft von mehr als hundert Leuten, einige haben an der Theologischen Akademie studiert, wohnten aber in einer WG, noch andere haben bereits hinter sich das keine-und das große Priesterseminar und schließlich sind einigen unter uns, die schon lange Priester sind.
Anhand dieser Vielfalt-Palette muss doch was Gemeinsames geben, eine Basis, auf der sich jeder entfalten und entwickeln kann: Meiner Meinung nach ist diese Basis – Jesus Christus, unser „tragendes Fundament“. Es muss sich in jedem Priesterseminar um diesen Jesus handeln. Es ging vor mehr zwei tausend Jahre nicht um die Apostel, sondern um den Sohn Gottes, Jesus Christus, der diese mit den Aufgaben betraut, seine Kirche aufzubauen und zu leiten. Interessant ist, dass Jesus alle seine Jünger zu sich ruft, aber nur zwölf auswählt und diese Apostel nennt. Also, alle Jünger sind in seine Nachfolge berufen, aber nur die Zwölf erhalten besondere Aufgaben: Sendung und Vollmacht (vgl. Mk 3,12-15). Sendung und Vollmacht aber nicht im Sinne Herren über die anderen zu sein, sondern Hirten und Diener, „denn der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele“ (Mk 10,43-45): Kurz gesagt, Merkmale eines Apostels, eines Priesters und auch eines Seminaristen ist seine Bindung an die von Jesus ausgewählte Aposteln sowie in Liebe geübte Dienstbereitschaft für alle.[1]
Derselbe Jesus, der mal die Zwölf ausgewählt hatte, hat auch Euch ebenfalls ausgewählt. Es waren vielleicht keine direkten Worte, geh und werde mein Apostel; es war vielleicht keine Erscheinung des Auferstandenen wie bei Paulus (vgl. Gal 1), sondern es waren Lebenssituation, besondere Momente, Vorbilder in der Erziehung, äußere Schönheit der Kirche, des Kirchengesangs oder auch eine leise innere Stimme…. All das diente dazu, mit Entschiedenheit ins Priesterseminar einzutreten.
Im Apostolischen Schreiben Pastores davo vobis ermutigt Papst Johannes Paul II., „niemals in der Kirche aufzuhören, den Herrn der Ernte zu bitten, dass er Arbeiter für seine Ernte aussende (vgl. Mt 9,38) und niemals aufzuhören, besondere Sorge auf die Ausbildung der Priesterkandidaten zu verwenden“ (PDV 2). Des Weiteren, so der Papst, steht zwischen Berufung und Aussendung der Priester eine Weile der Ausbildung von einigen Jahren. Und in dieser Ausbildung kommt nicht so sehr auf die Ausbilder an, vielmehr darauf an, ob sich der Seminarist für den Heiligen Geist öffnet und auf sich Mühe nimmt, Selbst-Bildung im Sinne des Hl. Geistes und der Kirchenlehre vorzunehmen. „Sicherlich muß auch und gerade der künftige Priester in dem Bewußtsein voranschreiten, daß für seine Ausbildung die Hauptperson schlechthin der Heilige Geist ist, der in der Gabe des neuen Herzens den Menschen nach dem Bild Jesu Christi, des Guten Hirten, gestaltet und ihm gleichförmig macht. In diesem Sinn bekräftigt der Kandidat die ihm eigene Freiheit auf die radikalste Weise, wenn er das Wirken des Geistes an sich heranlässt. Dies bedeutet seitens des Priesteramtskandidaten aber auch, daß er die menschlichen Vermittlungsformen, derer sich der Geist bedient, annimmt. Daher erweist sich das Handeln der verschiedenen Erzieher wirklich und in vollem Umfang nur dann als wirksam, wenn der künftige Priester ihm seine persönliche Überzeugung und herzliche Zusammenarbeit entgegenbringt“ (PDV 69).
Mir hat mal ein geistlich bewanderter Mann, im Hinblick auf die Ausbildungsjahre im Priesterseminar, folgendes gesagt: Man muss in all den Jahren nur die Liebe zu Hl. Liturgie in den Seminaristen wecken bzw. diese Liebe einpfropfen. Somit wird der Sinn der Ausbildungsjahre erfüllt. Liebe zur Liturgie einpfropfen und es genügt. Da diese Liebe nicht von heute auf morgen zu wecken sei, sondern ein langer Prozess des Heranwachsens ist, bis mal die Früchte zu erkennen sind, muss sie geübt werden. Und die Übungsplattform sich mit Liebe zur Liturgie einpfropfen zu lassen, kann unter anderem das Priesterseminar sein, eine Pflanzstätte, was aus dem Lateinischen seminarium hervorgeht.
Papst Benedikt XVI wendete sich an die Seminaristen bei dem XX Weltjugendtag in Köln im Jahre 2005 mit den Worten: „Das Seminar ist eine Zeit, die zur Ausbildung und zur Unterscheidung bestimmt ist. Die Ausbildung hat, […] verschiedene Dimensionen, die in der Einheit der Person zusammenlaufen: Sie umfaßt den menschlichen, den geistig-geistlichen und den kulturellen Bereich. Ihr tiefstes Ziel ist es, den Gott von innen her kennenzulernen, der uns in Jesus Christus sein Gesicht gezeigt hat. Darum ist ein gründliches Studium der Heiligen Schrift sowie des Glaubens und des Lebens der Kirche notwendig, in der diese Schrift lebendiges Wort bleibt. All dies muß in Zusammenhang stehen mit dem Fragen unserer Vernunft und so mit dem Kontext unseres menschlichen Lebens heute. […]Alles soll dazu dienen, eine kohärente und ausgeglichene Persönlichkeit zu entfalten, die imstande ist, die priesterliche Aufgabe gültig zu übernehmen und dann verantwortlich zu erfüllen.“[2]
Die Enzyklika Redemptor hominis (1979, 10f.) spricht von Menschen, der ohne Liebe nicht leben kann. Er bleibt für sich selbst ein unbegreifliches Wesen. Sein Leben ist ohne Sinn. […] In Christus aber findet der Mensch die Größe, die Würde und den Wert, die mit seinem Menschsein gegeben sind. Der Mensch wird neu bestätigt und in gewisser Weise neu geschaffen. Der Mensch, der sich selbst bis in die Tiefe verstehen will, muss sich mit seiner Unruhe und Unsicherheit, mit seiner Schwäche und Sündigkeit, mit seinem Leben und Tode Christus nahen“. Wenn ich diese Ausführung auf unsere Realität übertrage, hier im COr, dann kann ich mir selbst und jedem von euch nur empfehlen, eigene Größe, Würde und den Wert in Christus zu suchen. Und da kommen wir wiederrum zur Liturgie, wo Christus als Darbringender und Dargebrachter besonders erfahrbar wird. Er ist das, der in seiner Pflanzstätte der tüchtiger Winzer und zugleich der Weinstock ist. Er ist das, der seine berufeneren Jünger mit seiner Liebe einpfropfen will. Ohne diese tiefe Beziehung, ohne diese Liebe zur Liturgie sind wir, mit Paulus formuliert „dröhnendes Erz oder eine lärmende Pauke“ (1 Kor 13,1). Ohne dies ist ein Priester und auch ein Seminarist, der sich ja darauf vorbereitet „eine Art Mischung von weltlichen Berufen wie Sozialpfleger, Erwachsenenbildner, Lehrer, Heilpädagoge, Psychologe, Jugendführer, prophetischer Gesellschaftskritiker, Funktionär für die religiöse Angelegenheiten, Fachmann in Sachen Theologie“[3]. Ohne Liebe zur Liturgie wird stets den Priestern an Essenz fehlen, eins mit Christus zu sein. Für mich persönlich stellt sich die Frage, nicht was ich in der Gesellschaft oder auch in der Kirche leiste, sondern wer bin ich? Versuche ich mich mit Christus zu identifizieren? Oder eine Frage, was muss ich als Seminarist vor der Weihe bedenken, um ein guter Priester zu sein. Und zu bedenken wäre nicht wenig! Einerseits königliches Priestertum, andererseits eigene Sündhaftigkeit und Schwäche… Diese zwei Polen finden wir wiederrum in der Liturgie, indem der Priester betet, dass „wir auf geheimnisvolle Weise die Cherubim darstellen“ und zugleich dass „niemand würdig ist zu Ihm zu kommen, Ihm zu dienen, wenn er von Leidenschaften und fleischlichen Begierden“ geplagt ist. „Gott sei mir Sünder gnädig und erbarme Dich meiner“, die mehrmals gebetet wird, ist der Ausdruck dessen, dass der Priester Gnade und Barmherzigkeit Gottes bedarf. Liebe die Liturgie und es genügt!!!
Damit die Liturgie zu einer Quelle der Heiligung werde, darf sie niemals als ein Termin abgehakt werden, sondern sie muss als Höhepunkt geistlichen Lebens verstanden werden, als „geistliche Tankstelle“ für uns. Und es hängt nicht davon ab, ob man täglich zu dieser „Tankstelle“ kommt, oder vielleicht nur am Sonntag und an Festtagen, an denen sie mit noch größerer Freude und Ehrfurcht gebetet wird. Man darf auch nicht vergessen, dass Liturgie oder andere Gottesdienste keineswegs von Priester instrumentalisiert werden dürfen, wo er sich selbst darstellt. Schließlich ist die Liturgie wie auch jeder Gottesdienst eine Begegnung mit Gott und ein Opfer. In den Opferzustand versetzt uns nicht nur in der Früh klingender Wecker, sondern auch der Heilige Geist, der dann in der Liturgie auf die Gaben und uns herabkommt und heiligt. Liebe die Liturgie und es genügt!!! Sei dir deiner Würde und deiner Sündhaftigkeit bewusst!!! Amen.
[1] Vgl. J. Hofmann, Zentrale Aspekte der Alten Kirchengeschichte I, Würzburg 2012, 29.
[2] http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/de/speeches/2005/august/documents/hf_ben-xvi_spe_20050819_seminarians.html
[3] G. Greshake, Priester sein in dieser Zeit, Freiburg u. a. 2000, 279.