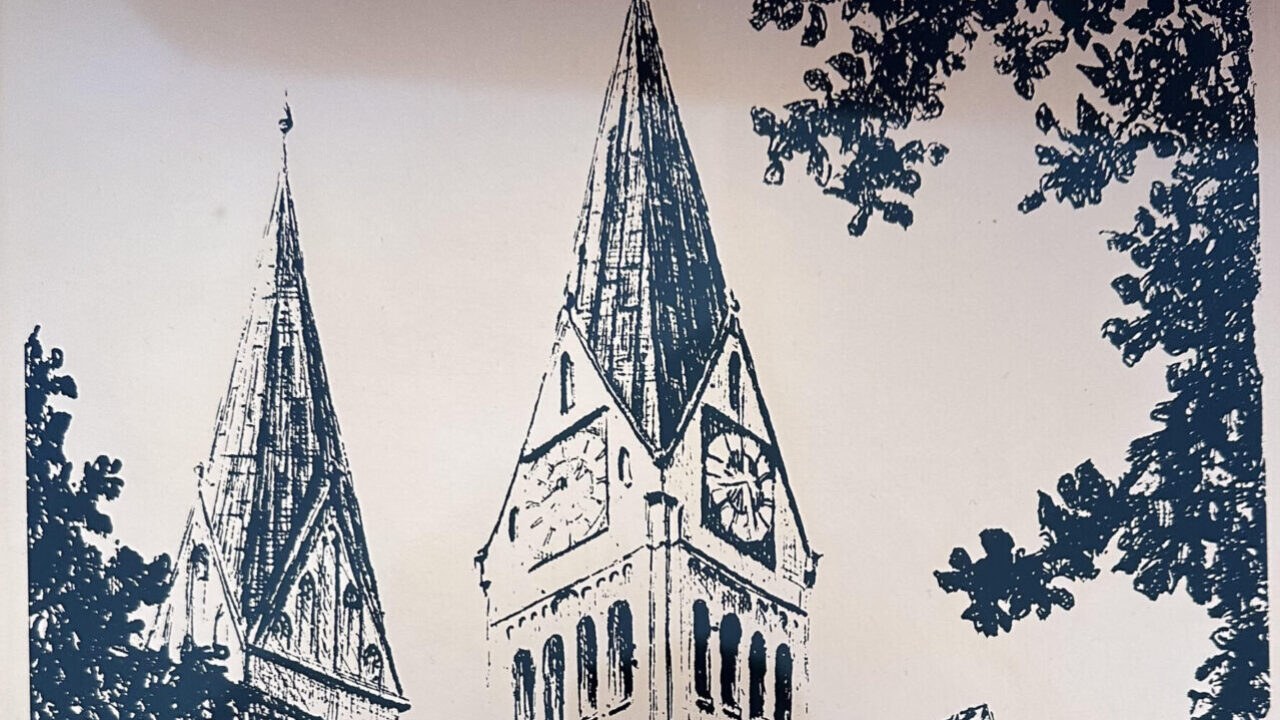Tag für Tag näht sich das Sommersemester seinem Ende zu. In den 12 Tagen ist es so weit: Dann oder noch früher, wie heute z. B. für die Sprachstudenten, beginnt eine Zeit für die vielerlei Prüfungen, Portfolio oder mündliche Selbstverteidigung vor den Professoren. Doch diese Prüfungszeit dauert nicht lange und die Freude auf die Sommerferien wird immer größer. Die Sommerfeien an sich sind ja dazu gedacht, dass der mit wenig Schlaf geplagte Kollegiat endlich mal zu Kräften kommt und nicht mehr in der Früh aufstehen muss. Die Ferien an sich sind also für die Erholung, für Reisen, für neues Kennenlernen gedacht oder für die Nachholung dessen, was man nicht geschafft hat. Das deutsche Wort „Ferien“ kommt aus dem Lateinischen feriae und bedeutet „Fest,- Feiertage“, an denen die gottesdienstlichen Handlungen vorgenommen werden. Von daher gesehen könnte das ganze Semester in diesem wortgetreuen Sinne verstanden werden. Was vielleicht mit ein wenig Ironie ausgesprochen ist, gibt uns allen einen wichtigen Impuls für die kommende Zeit, in dem wir uns einige Frage stellen sollen: Wie will ich meine „Festtage“ gestalten? Will ich in diesen sogenannten Festtagen auch die kirchlichen Feste in einer Vesper oder Liturgie begehen, wie z. B. Verklärung Jesu, Entschlafung Mariens, Kreuzerhöhung und viele andere. Oder vielleicht nehme ich mir vor, soweit es geht, täglich in die Liturgie zu gehen? Denn uns wird die schöne Zeit geboten, in der jeder und jede für sich Verantwortung für das geistliche Leben tragen wird.
Um Euch schon jetzt ein wenig für diese Sommerferien zu begeistern, möchte ich gerne über die Mitfeier der Göttlichen Liturgie am Werktag und am Sonntag nachdenken, insbesondere in den Ferien. Manche von euch werden vielleicht einen Ferienjob machen und werden bereits um fünf Uhr aufstehen müssen; machen werden verreisen, aber doch einige werden hier bleiben. Denk bitte immer daran, egal, wo ihr euch aufhält, an eure Berufung und eure Lebensführung. Wenn es auch nicht klappt, wegen der Arbeit jeden Tag die Liturgie mitzufeiern, dann wenigstens am Sonntag und an kirchlichen Großfesten. Das persönliche Gebet, das man überall sprechen kann, soll praktiziert werden. Im geistlichen Leben eines Christen, eines Kollegiaten und eines Priesters gibt es kein Standbay-Modus, keine Ferien. Sprechen wir von der Mitfeier der Liturgie, lohnt es sich dem Auftrag Jesu, tut dies zu meinem Gedächtnis, Folge zu leisten. Auch Apostel Paulus wird nicht müde, die ersten Christen über die rechte Feier des Herrenmahles zu unterweisen (1 Kor 11,17-34). Der Hl. Ignatius von Antiochien († 117) lädt im Angesicht des eigenen Martyriums zum „Brotbrechen“ ein, denn das ist die Arznei zur Unsterblichkeit, die Medizin, die den Tod verhindert, vielmehr ermöglicht, fort und fort in Jesus Christus zu leben (Brief an die Epheser 20,2). Ganz im Sinne des Ignatius schreibt Cyrill von Alexandrien (†444) in der Unterweisung über die Eucharistiefeier folgendes: „Kommt, kostet und seht, wie süß der Herr ist! Urteilt nicht nach dem Gaumen, sondern nach dem festen Glauben! […] Trittst du vor, dann darfst du nicht die Hände flach ausstrecken und nicht die Finger spreizen. Da die rechte Hand den König in Empfang nehmen soll, so mache die linke Hand zum Thron für ihn! Nimm den Leib Christi mit hohler Hand entgegen und erwidere: Amen! Berühre behutsam mit dem heiligen Leib deine Augen, um sie zu heiligen. Dann genieße ihn! Doch habe acht, daß dir nichts davon auf den Boden falle. […] und genieße, um dich zu heiligen, auch vom Blute Christi. Solange noch Feuchtigkeit auf deinen Lippen ist, berühre die Augen, die Stirne und übrigen Sinne.“ (Mystagogische Katechese 5,2-11; 19-23.). Vor diesem Hintergrund sehen wir, liebe Mitbrüder, wie wichtig die Litugie für die Christen aller Zeiten war und ist. Zu betonen ist, dass hl. Cyrill zweimal die Augen erwähnt, die durch Berührung mit dem Allerheiligsten geheiligt werden, als ob er auch unsere Augen vor den schädlichen Bildern bewahren wollte. Fast zur gleichen Zeit, aber nicht mehr in Alexandrien, sondern in Konstantinopel beschreibt Chrysostomos eine andere Praxis unter den Christen, was die Feier der Liturgie und den Kommunionempfang angeht.
Viele Menschen empfangen den Leib Christi scheinbar gedankenlos und aus Gewohnheit, ohne viel Nachdenken, so Chrysostomus. Ob es die heilige vierzigtägige Fastenzeit oder das Fest Epiphanie ist, man empfängt die Sakramente, egal in welchem Zustand man sich befindet. Doch es ist nicht die Zeit allein, wann wir zum Tisch des Herrn treten. Entscheidend ist die Reinheit und Unbeflecktheit der Seele. Nur mit dieser sollte man sich nähern, ohne sie niemals! Die hl. Schrift sagt: „So oft ihr dies tut, sollt ihr den Tod des Herrn verkündigen“ – das bedeutet, dass wir uns an das Heil erinnern sollen, das Christus für uns erwirkt hat, an die Gnade, die er uns erwiesen hat. […] Chrysostomus vergleicht die Seele mit den liturgischen Gefäßen, indem er sagt: Die Gefäße haben keinen Anteil an dem, was in ihnen aufbewahrt wird, sie empfinden nichts davon; aber wir tun es. […] Die Gefäße werden immer rein gehalten, damit sie glänzen, wir aber sollen uns bemühen, auch die eigene Seele rein zu bewahren. […] Das heilige Opfer wird täglich umsonst dargebracht, wir stehen umsonst täglich am Altar: Niemand empfängt die Kommunion. Ich sage dies nicht, damit du die Kommunion leichtfertig empfängst, sondern damit du dich würdig machst. – Wenn du des Opfers, der Kommunion unwürdig bist, dann bist du auch des Gebets unwürdig. Einen interessanten Zusammenhang stellt also der Erzbischof von Konstantinopel fest zwischen dem Kommunionsempfang und dem Gebet, und zwar: […] Ich bin der Kommunion nicht würdig, sagst du? Dann bist du auch nicht würdig jener Teilnahme, die in den Gebeten liegt. Denn nicht allein durch die vorgesetzte Speise, sondern auch durch jene Gesänge kommt der Geist allseits herab.
Man könnte noch lange diese Gedanken ausführen, doch dies würde unseren zeitlichen Rahmen sprengen, deshalb möchte ich nur einen Punkt aufgreifen, mit dem eigentlich auch Chrysostomus seine Überlegungen über würdige Teilnahme in der Liturgie abschließt. Dieser Punkt aus dem 4. Jahrhundert zeigt uns den Christen, Kollegiaten und Priester des 21. Jahrhundert nur eines: Als Menschen sind wir alle schwach, von Natur aus sind wir zugeneigt, in die Fremde zu ziehen, Fehler zu machen, Sünden zu begehen. Für all das kann man sich letztendlich entschuldigen. Nur eines lässt sich nicht entschuldigen: Gleichgültigkeit, Lauheit und Leichtsinn. „Unser Leichtsinn allein ist es, der uns unwürdig macht“ – sagt Johannes Chrysostomus. Und ein anderer Johannes möchte dies nur unterstreichen, liebe Kollegiaten, und euch eine einzige Botschaft mit auf den Weg in die Sommerferien geben: Seid nicht gleichgültig! Amen.