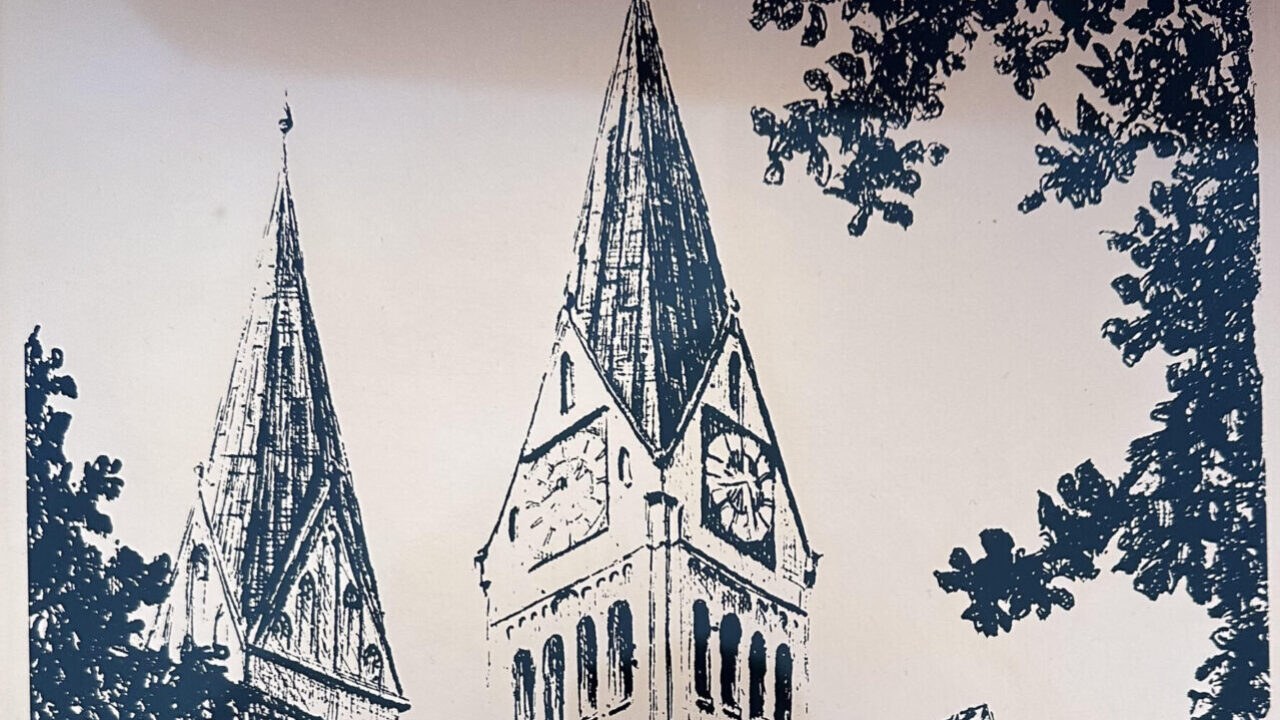Von Versöhnung und Buße zu sprechen heißt das öfters, sich in Privatsphäre des Menschen einmischen und ins Gewissen einreden zu wollen. Öfters kann man hören, und nicht selten unter den Christen, dass man keinen getötet, nichts geklaut, keinen betrogen hat, wieso muss man noch beichten. Aber ist die Beichte, Versöhnung und Buße wirklich nur ein Abhacken schwerer Sünden? Oder beschränkt sich die Beichte nur auf diese drei Verfehlungen? Oder ist vielleicht die Versöhnung ein lebenslanger Prozess, eine lebenslange Bekehrung, Umkehr in dem Bewusstsein, dass man nie vollkommen ist und ständig auf Gottes Gnade angewiesen ist. Darum sagt hl. Gregor von Nazianz in seiner Verteidigungsrede auf das Priestertum, dass es, um sich der Macht der Sünde zu widersetzen, „eines starken […] Glaubens, reichlichen göttlichen Beistandes und […] nicht geringer Anstrengung unserseits in Wort und Tat […] bedarf“[1]. Neben Glauben und Gottes Gnade also darf es nicht an eigener Anstrengung fehlen, anderes gesagt man bedarf eines Askese-Denkens im Sinne „sich bemühen“, wie es Paulus in Apg 24,16 dem römischen Statthalter Felix zu verstehen gibt: „Deshalb bemühe (ἀσκῶ) ich mich auch, vor Gott und den Menschen immer ein untadeliges Gewissen zu haben“. Für Paulus ist das Gewissen ein in das Herz des Menschen aufgeschriebenes Gesetz (vgl. Röm 2,12-16), anderes formuliert ist das Gewissen ein Wächter des Verhaltens, ein Indikator der Stimme Gottes in Menschen. Der Zweck eines Indikators ist ein Hinweisen und ein Anzeigen als Hilfe zu einer neuen Erkenntnis. Übertragen auf geistliche Ebene wird im Sakrament der Versöhnung jedem eine Erkenntnis gegeben, dass man sich mi Gott, mit den Nächsten und mit sich selbst versöhnen muss. Das sind sozusagen drei Ausrichtungen einer Beichte, ja drei Elementen, die eng miteinander verbunden sind. Aus dem Katechismus sind fünf Voraussetzungen für eine Beichte allen bekannt: Gewissenserforschung, Reue für die begangenen Sünden, Vorsatz die Sünde zu meiden, Bekenntnis der Sünden und Erfüllung der auferlegten Buße (KKK 1491). Hier aber stellt sich die Frage, ob mit der Erfüllung dieser Voraussetzungen, man kann auch sagen eines Minimums, eine wirkliche Umkehr, μετάνοια geschieht. Denn aus dem Griechischen bedeutet μετάνοια nichts anderes als Umdenken, Sinnesänderung, Umkehr des Denkens. Und wenn man nach hebräischem Äquivalent sucht, ist mit dem Wort הבוש (schub) einiges mehr gemeint.[2] Damit ist nämlich gemeint eine radikale Wendung nicht nur im Denken, sondern in der ganzen Existenz, die Veränderung des Verhaltens, vor allem aber auch neuer Gehorsam gegenüber Gott, neues Vertrauen zu ihm, die sich in konkreten Taten ausdrucken. In Mt 3,8 heißt das „Bringt Frucht, die der Umkehr angemessen ist!“ Und der erste Ausruf bzw. Forderung Jesu im Markusevangelium heißt: „Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um, und glaubt an das Evangelium!“ (Mk 1,15). Im apostolischen Schreiben Reconciliatio et paenitentia (Versöhnung und Buße) wird der hl. Papst Johannes Paul II. nicht müde zu betonen, dass Metánoia „die innere Umkehr des Herzens unter dem Einfluß des Wortes Gottes und mit dem Blick auf das Reich Gottes“ ist. Buße zu tun bedeutet „das Leben zu ändern in Übereinstimmung mit der Umkehr des Herzens“. „Die ganze Existenz wird in die Buße einbezogen, das heißt, sie ist bereit, beständig zum Besseren voranzuschreiten. Buße tun ist allerdings nur dann echt und wirksam, wenn es sich in Akten und Taten der Buße konkretisiert. In diesem Sinne bedeutet Buße im theologischen und geistlichen christlichen Sprachgebrauch Aszese, das heißt die konkrete und tägliche Anstrengung des Menschen, mit Hilfe der Gnade Gottes sein Leben um Christi willen zu verlieren […]; den alten Menschen abzulegen und den neuen Menschen anzuziehen; alles in sich zu überwinden, was »fleischlich« ist, damit das »Geistliche« sich durchsetze“[3] (RP 4).
An der Stelle darf nicht vergessen werden, dass die wirkliche μετάνοια immer ein Geschenk, eine Einladung zum Leben in Fülle ist, zum Leben mit Gott (vgl. Apg 11,18) und ein Herausführen von Irrtum zur Wahrheit (Jak 5,19f.). Gott ist vor allem ein liebender Vater und nicht einer, der mit Peitsche steht und wartet, um nur zu bestrafen. Aber Gott ist auch gerecht und meint mit den Menschen immer gut. Er will sein bestes, darum lässt er manchmal einiges zu, damit der Menschen selber kapiert, dass sein Weg ohne Gott in die Ferne, in geistliche Armut und äußerste Not führen kann. Sünde zerstört die communio mit Gott und die innere Harmonie, den inneren Frieden in Menschen. „Innerlich zerrissen, erzeugt der Mensch fast unvermeidlich einen Riß [in] Beziehungen mit den anderen Menschen und mit der geschaffenen Welt“ (RP 15). Wie der Mensch sich von Gott entfernen und danach innere Zerrissenheit und tiefe Sehnsucht nach „Vaterhaus“ empfinden kann, zeigt uns die Erzählung vom verlorenen Sohn bzw. dem barmherzigen Vater im Lukasevangelium (Lk 15,11-32).
„Der leichtsinnige Weggang aus seinem Vaterhaus, [die Verlockung einer illusorischen Freiheit], die Verschwendung all seines Besitzes in einem ausschweifenden Lebenswandel ohne Sinn, die dunklen Tage der Fremde und des Hungers, aber mehr noch die Tage der verlorenen Würde, der Erniedrigung und Beschämung und schließlich die Sehnsucht nach dem Vaterhaus, der Mut zur Heimkehr, der Empfang durch den Vater – [all das erfährt der Sohn]. [Der Vater aber] hatte den Sohn keineswegs vergessen; im Gegenteil, er hatte ihm unverändert Liebe und Achtung bewahrt. So hatte er immer auf ihn gewartet, und so umarmt er ihn jetzt, während er zum großen Fest für denjenigen auffordert, der tot war und wieder lebt, der verloren war und wiedergefunden wurde.“[4]
Was an diesem Gleichnis am meisten beeindruckt, ist die festliche und liebevolle Aufnahme, die der Vater dem heimkehrenden Sohn bereitet: ein Zeichen der Barmherzigkeit Gottes, der immer bereit ist zu verzeihen. Die Versöhnung also ist in erster Linie ein Geschenk des himmlischen Vaters und die Beichte ist die liebende Umarmung des Vaters. In seinen umarmenden Armen wird jedem Gottes Barmherzigkeit und Vergebung zuteil. Nicht nur der jüngere Sohn hat sein Ziel verfehlt, sondern auch der ältere, der die Freude des Vaters nicht teilt und dessen Festmahl verschmäht. Er wird wütend, neidisch und macht dem Vater Vorwürfe. Er hält sich für besser und treu, aber letztendlich bleibt er einer, der sich ebenfalls vom Vater entfernt. Er fühlt sich beschränkt in seiner Freiheit, Freude am Dienen im Vaterhaus hat er auch nicht. Skrupulös und wie ein Funktionär oder Roboter erfüllt er seine Aufgaben. Auch zu ihm geht der Vater hinaus und bittet ihn einzutreten und sich über das Zurückkehren seines Bruders zu freuen. Aber die egoistische Überzeugung von eigenen Verdiensten, Eifersucht, Verachtung des Bruders, Wut, Zorn und Sich-für-besser halten verhindern die Versöhnung mit dem Vater und mit dem Bruder.[5] Jeder Mensch hat in sich sozusagen zwei Arten der Sohnschaft bzw. des Verhaltens dem Vater gegenüber. Man entfremdet sich vom Vater in jeder Hinsicht, ähnlich wie die beiden Söhne. Und Seminaristen, Priester und auch Bischöfe sind keine Ausnahme. Jeder kann auch der Gefahr laufen, sich für besser haltend als andere, vergessend dabei, dass man auf diese Weise dem älteren Sohn ähnlich wird. Wie der ältere Sohn seinen Aufgaben erfüllt hat, kann auch Priester alles von ihm Geforderte erfüllen, aber ohne innere Freude und Dankbarkeit, und so wird, wie Metropolit Sheptytskyy sagte, das Seil innerer Verbundenheit mit dem Vater auseinandergerissen.[6]
Im Licht des unerschöpflichen Gleichnisses von der Barmherzigkeit Gottes, die die Sünde tilgt, versteht die Kirche […] ihre Sendung, auf den Spuren des Herrn für die Bekehrung der Herzen und die Versöhnung der Menschen mit Gott und untereinander zu wirken, zwei Bereiche, die eng miteinander verbunden sind. Darum ist es sehr wichtig für die Priester und die Seminaristen, dieser Sendung sich bewusst zu sein. Nur einer, der sich selber erfährt als einer, der sich vom Vater entfernt hat, kann auch den anderen den Weg weisen. Nur einer, der sich selber vom Vater umarmen lässt, kann auch später aus dieser Erfahrung der verziehenden Liebe Gottes ein guter Beichtvater werden. Davon ausgehend wird ausdrücklich betont, dass Priester als Diener der sakramentalen Gnade „aufs innigste [mit Christus verbunden werden] durch den würdigen Empfang der Sakramente, vor allem durch die häufig geübte sakramentale Buße“, die notwendige Hinwendung des Herzens zur Liebe des Vaters fördert (PO 18).
Denn als künftige Priester müsst Ihr das Vorbild des barmherzigen Vaters zu eigen machen und fähig sein, sich über jeden heimkehrenden Sohn zu beugen. Ihr müsst auch umsichtig und klug sein, um etwa den Weg zur Versöhnung mit unüberlegten Fragen nicht zu versperren. Hilfe und Ermutigung und geeignete Ratschläge dem Beichtenden gegenüber gehören auch dazu. Nicht zu vergessen ist aber, dass sowohl der Priester als auch der Beichtender als Sünder vor Gott hintreten, um seine Barmherzigkeit zu erbitten. Denn „in der Beichte geht es keineswegs bloß um ein moralisches Check-in, sie will vielmehr vor allem unmittelbar in die Begegnung mit [dem barmherzigen Gott] führen. Deshalb kann es bei der Beichte nicht darum gehen, irgendetwas […] zu beichten, der einzelne hat sich und sein Leben zu beichten, indem er die eigene Haltung bedenkt, die den einzelnen Handlungen und Verfehlungen zugrunde liegt. Das Bußsakrament darf insofern als eine ‚zweite Taufe‘ bezeichnet werden, denn durch dessen Empfang der einzelne die Möglichkeit und Kraft erhält, im Glauben und in der eigenen Berufung zu wachsen und sich zu erneuern.“[7] In diesem Sinn, ähnlich wie bei der hl. Taufe, bedarf auch die Beichte einer Vorbereitung, einer Besinnung, eines Umdenkens. Sie darf nicht ablaufen nach dem Motto „hier schnell um die Ecke“, sondern sie braucht einen gewissen geistlichen Rahmen, Rituale, feste Zeit und Raum.[8] Trotzdem entscheidend bleibt, dass nicht der Mensch, der die reue zeigt, die Sündenvergebung bewirkt, und auch nicht der Priester, sondern allein Gottes freie Barmherzigkeit und Gnade. Amen.
[1] Gregor von Nazianz, Rede II,21 (BKV), in: https://bkv.unifr.ch/works/144/versions/163/divisions/90479
[2] Für Belege siehe W. Gesenius, Handwörterbuch, Berlin u.a. 1962, 810f.
[3] Apostolisches Schreiben Reconciliatio et paenitentia, in: http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/de/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_02121984_reconciliatio-et-paenitentia.html
[4] RP 5.
[5] Vgl. RP 6; KKK 1439.
[6] Vgl. A. Šeptycʹkyj, Pastyrs’ki poslannja: dokumenty i materialy I / 1899 – 1914, L’viv 2007, 199-239, hier 200f.
[7] M. Schneider, Geistliche Begleitung und Beichte, Köln 2010, 12.
[8] Vgl. M. Schneider, Instrumentarium des geistlichen Lebens, Köln 22009, 85-100.