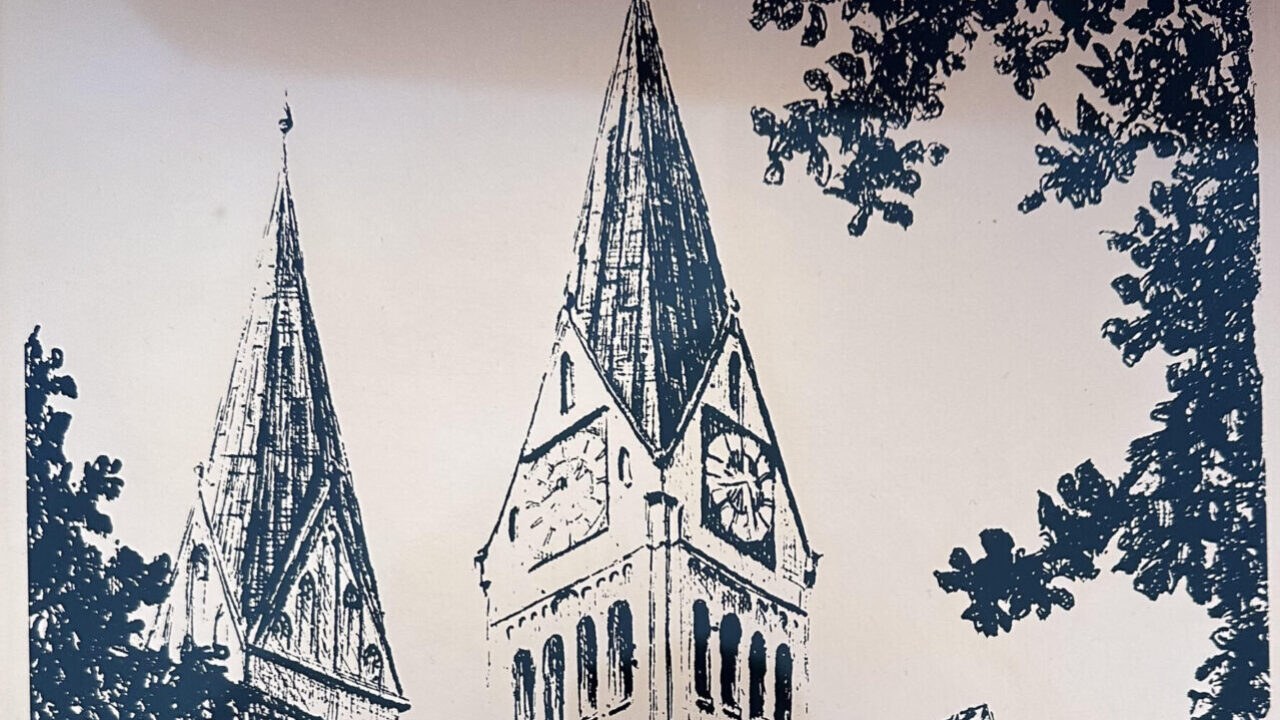Ingolstadt, eine Stadt, die weltbekannt ist durch die Autoproduktion „Audi“. Seit mehr als 70 Jahren werden dort Autos gebaut. Heutzutage arbeiten bei AUDI-Werk fast 45 Mio. Mitarbeiter und jeder trägt auf seine Weise dazu bei, dass der „Vorsprung durch Technik“ nicht nur sichtbar wird durch das Optische, sondern auch hörbar durch das Funktionieren jedes Teils. Das Wort „audi“ ist das lateinische Imperativ von „audire“ und bedeutet „höre“, „horche“, und ist eine Anspielung auf den Firmengründer August Horch. Höre, wie das Auto fährt, lausche seinen Geräuschen; lass dich von diesem Hören überzeugen und fange an zu handeln sind öfters Aufrufe in der Werbeindustrie.
Unser heutiges Thema ist das Hören in seinen verschiedenen Aspekten. Denn der Priester bzw. der Seminarist soll auch, wie die Kunden von Audi, ein offenes Ohr haben, aber nicht für das Bewundern der Technik, sondern ein offenes Ohr auf die Stimme Gottes. Wenn der Priester von anderen gehört werden will, muss er selber hören lernen und zwar in zweierlei Hinsicht. Zu einem auf die Stimme Gottes zu hören, dem Gottes Ruf zu lauschen, was nur in Stille, und nicht in der Hektik, möglich ist. Zum anderen auch fähig zu sein, selber anderen Menschen aufmerksam zuzuhören, Nöte und Regungen zu erkennen, verschiedene Geister zu unterscheiden. Ohne das erste wird nie das zweite gelingen. Nur kurzer Blick in die Bibel reicht aus, um festzustellen, dass dort vielmals die Rede vom Hören ist.
Das hebr. Wort „עמשׁ-shama“ wird sowohl mit „Hören“ als auch mit „Gehorchen“ wiedergegeben. Da wird also nicht zwischen Hören und Gehorchen unterschieden. In unserem Sprachgebrauch gibt es eine Unterscheidung zwischen den beiden Worten, man kann zwar hören, aber ohne zu gehorchen. Wer hört und nicht gehorcht, hat in den Augen Gottes nicht richtig gehört! Richtiges Hören beinhaltet also nicht nur das Aufnehmen und Speichern einer Information, sondern auch das Verarbeiten und Zu-Eigen-machen einer Aussage. Wenn Gott in unser Leben hineinspricht und wir dieses Reden nicht beachten und wenn dieses Reden keine Auswirkungen in unserem Leben hat, dann haben wir nicht richtig gehört. Auf Gott gehört haben wir erst dann, wenn sich das Gesagte auf unser Leben auswirkt und sich mit unserem Leben verbindet. Zwei Bespiele, einmal aus dem AT, und einmal aus dem NT sollten dem biblischen Verständnis vom „Hören“ uns näher bringen.
In 1 Sam 3 offenbart sich Jahwe Samuel im Tempel, in dem die Bundeslade Gottes stand und, in dem die Lampe Gottes noch nicht verloschen war. Vom Schlaf erweckt hört der Junge seinen Namen sprechen: Samuel! Gott ruft ihn also beim Namen und will eine Botschaft mitteilen. Was macht dann Samuel? Erschreckend sagt er „Hier bin ich“ und anstatt weiter zuzuhören, läuft er zum Priester Eli und weckt den alten Greisen auf. Du, geh schlafen antwortet er dem Samuel, bis die beiden erst beim dritten Mal verstanden haben, dass es der Herr ist, der den Samuel ruft und von ihm gehört werden will. Dann ruft Jahwe zweimal Samuel, Samuel!, worauf der Junge erwidert: Rede, Herr; denn dein Diener hört“, wörtlich übersetzt dein Knecht ist hörbereit. Solche Bereitschaft zum Hören ist notwendig für die Entgegennahme der göttlichen Offenbarung. Bereitschaft zum Hören bzw. Bereitschaft zum Gehorchen ist die Voraussetzung dafür. Im Falle Samuels teilt Jahwe erst, nachdem er bereit war zu hören, seine Botschaft mit und als Folge darauf beginnt Samuel zu handeln. Er öffnet die Türen zum Haus des Herrn und wird zum Propheten für ganz Israel. Aus diesem Beispiel erkennt man, dass es nicht ausreichend ist nur hier bin ich zu sagen, sondern vielmehr ist die Bereitschaft zu hören gefragt. Hören und danach handeln wie Samuel.
Das andere Beispiel ist in Lk 1 zu finden. Der Engel Gabriel trat bei Maria ein und sagte: „Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir […]. Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden“. Auch hier ruft der Engel die Jungfrau beim Namen. Nach ein paar Klärungsfragen gehorcht Maria dem Wort des Engels und beginnt zu handeln: „Ich bin die Magd des Herrn; mir geschehe, wie du das gesagt hast“. Diesem Ja zum Herrn fühlte sich Maria das ganze Leben verpflichtet, angefangen mit Josef, ihrem Bräutigam, der sie verlassen wollte, dann ihr Weggehen ins Bergland von Judäa und der dortige dreimonatige Aufenthalt bei Elisabeth, vermutlich aus dem Grund, weil sie in Nazareth geschmäht wurde und schließlich all die Ereignisse um die Geburt und das Wirken Jesu bis zu seinem Tod am Kreuz.
Auch aus diesem Beispiel erkennt man folgendes: Marias Empfängnis geschieht zuallererst durch das Ohr, denn sie ist bereit zu hören und zu gehorchen. Bevor der Heilige Geist über sie kommt und die Kraft des Höchsten sie überschatten, empfängt Maria diese Botschaft zunächst durch das Ohr, und erst danach wird sie zur Wohnung für den Sohn Gottes. Nicht zufällig haben „die Theologen vom 4. Jahrhundert bis hinauf ins hohe Mittelalter die Ansicht vertreten, dass Maria Jesus durchs Ohr empfangen hat.[1] Diese Ansicht geht indirekt auf den Apostel Paulus zurück, der Christus bildhaft als «neuen Adam» bezeichnet: «Ist durch die Übertretung des Einen [nämlich durch Adams Sündenfall im Paradies] der Tod zur Herrschaft gekommen, so werden alle leben durch den Einen, nämlich Jesus Christus» (Röm 5, 17). Da aber am Sündenfall nicht nur Adam beteiligt war, sondern auch Eva, kam man schnell auf die Parallele zwischen ihr und Maria. Ausformuliert findet sich dieser Gedanke erstmals beim Bischof Irenäus von Lyon (gestorben um 202): «Der Knoten des Ungehorsams der Eva wurde durch den Gehorsam Marias gelöst; denn was die Jungfrau Eva durch ihren Unglauben verschnürt hatte, das löste die Jungfrau Maria durch ihren Glauben.» Gemäß der biblischen Überlieferung hat Eva auf die Einflüsterungen der Schlange gehört. Was Bischof Zeno von Verona im 4. Jahrhundert zu einer kühnen Schlussfolgerung veranlasste: «Durch Überredung hatte sich der Teufel in Evas Ohr eingeschlichen; durch das Ohr trat mithin Christus in Maria ein.» Darum kam diese Sicht von der Empfängnis Mariens durchs Ohr auch in die Kunst des 14. – 15 Jhs., wie das Fresko aus dem Kreuzgang des Doms zu Brixen oder das Nordportal der Marienkapelle in Würzburg zum Ausdruck bringen.
Samuel und Maria zeigen auch uns Priestern, Seminaristen, wie wichtig es ist auf die Stimme Gottes zuzuhören, zu gehorchen und danach handeln. Das aufmerksame Hören ist gemeinschaftsstiftend mit Gott und mit den Menschen: „Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten und wir werden Mahl halten […]“ lesen wir in Offb 3,20. Selbst der Apostel Paulus in Röm 10,14-19 schreibt, dass der Glaube nicht vom Sehen, sondern vom Hören kommt.
Wie sieht es denn mit dem Hören zwischen den Menschen, zugespitzt gesagt zwischen Priestern und Gläubigen in der Gemeinde?
[1] Vgl. hier und im Folgenden J. Imbach, Weder Schönheit noch Frömmigkeit, in: Neue Zürcher Zeitung, Artikel vom 24.12.2010 bei / https://www.nzz.ch/weder_schoenheit_noch_froemmigkeit-1.8864145