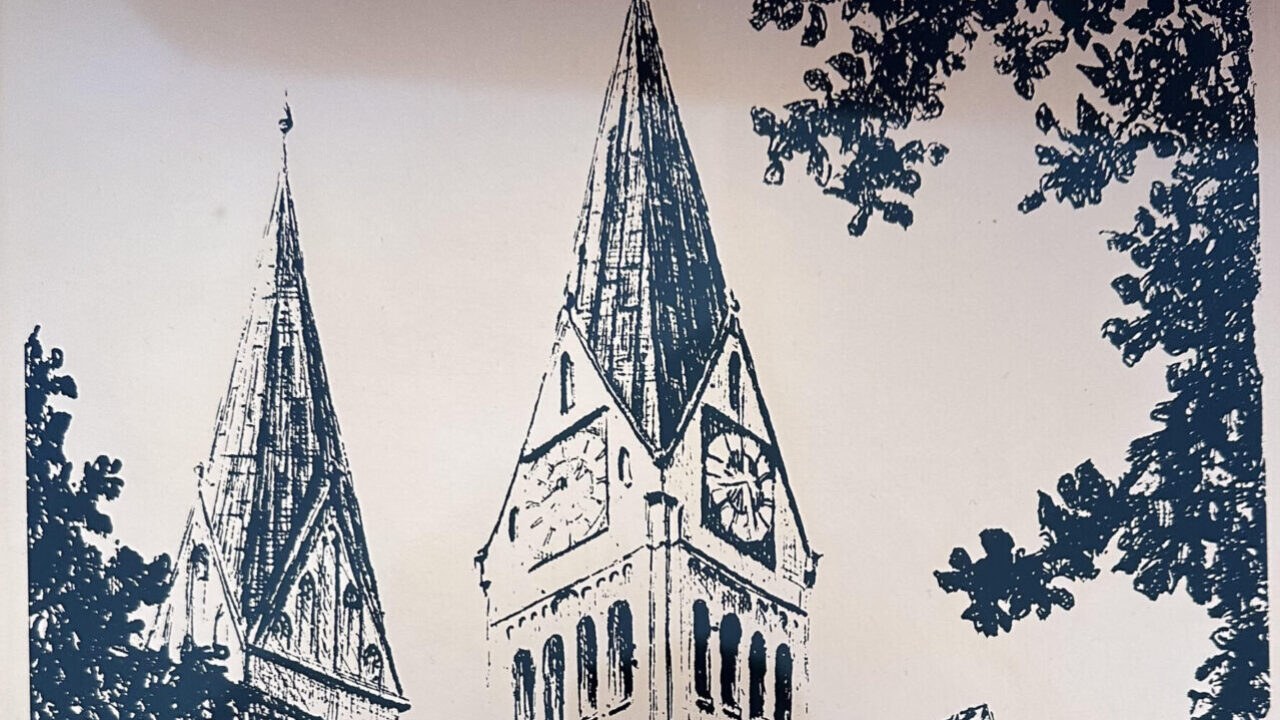In der 5. Seligpreisung wendet sich Jesus zu seinen Zuhörern mit einem kurzen Satz: „Selig die Erbarmenden bzw. Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden“. Was ist das Erbarmen Gottes? Worin erweist es sich? Ist menschliches Erbarmen überhaupt möglich? Wenn ja, worin erweist es sich?
In der hellenistischen Welt verstand man unter dem Erbarmen oder Mitleid (ἔλεος) eine emotionale Rührung im Angesicht des Leids oder Übels anderer. Diese Emotion war zugleich, egoistisch motiviert, mit der Hoffnung verbunden, selbst nicht so ein Leid erfahren zu müssen und davon verschont zu bleiben. In der Stoa war das Gefühl des Erbarmens, des Mitleids einer Leidenschaft oder einer Krankheit der Seele zugerechnet. In der Septuaginta ist das ἔλεος eine Wiedergabe des Wortes חסד (chesed), das Gunst, Güte, Gnade, Wohlwollen, Barmherzigkeit und Liebe bedeuten kann. Das letztgenannte Wort, die Liebe, ist das Leitwort zum Verständnis der 5. Seligpreisung, denn es ist unmöglich jemandem Erbarmen zu erweisen, wenn man keine Liebe zu ihm hat. Mit dem erwähnten hebräischen Wort wird eine Beziehung zwischen Gott und Mensch zum Ausdruck gebracht, das Verhältnis, das sich in der Bundestreue manifestierte, JAHWE und Israel. Nur ein Verhältnis, das seinen Ursprung in Gott hat, kann auch den Menschen untereinander Sicherheit geben. Gott ist zu uns gütig und erbarmungsvoll, aber er fordert von uns auch solches Verhalten in den zwischenmenschlichen Beziehungen und fördert es mit seiner Gnade. Gottes Erbarmen, Güte und Liebe erweisen sich immer als eine treue Hilfe, auch dann wenn sich der Mensch ihm gegenüber manchmal, ohne Absicht, untreu verhält. In so einem Fall geht Gottes Gnade in eine verzeihende Gnade über, die bis zur endgültigen Erlösung von aller Not hinführt. Die helfende Treue des Menschen soll nie ein Affekt, nie eine egoistische Angst sein, sondern eine Tat, die aus Liebe hervorgeht; sie ist eine ausgestreckte Hand, ein Eilen zur Hilfe, das sich Eins-Fühlen und sich Eins-Wissen mit einem anderen, ein Verbundenheitsgefühl. Dieses Verbundenheitsgefühl verlangte Gott von seinem Volk Israel, und das gleiche verlangt Gott auch von uns, nämlich ihm treu zu bleiben. Die Untreue der Israeliten zeigte sich darin, dass sie anderen Göttern opferten und huldigten, dass sie sich von seinem Gott entfernten. Immer wieder musste Gott mit seiner Güte seinem untreuen Volk zur Hilfe eilen. Gott handelte sehr konkret, er half seinem Volk und rettete es wiederholt, unabhängig von dessen Vergehen und Sünden. Denn „der Herr ist barmherzig und gnädig, langmütig und reich an Güte. […] Er handelt an uns nicht nach unsern Sünden und vergilt uns nicht nach unsrer Schuld“ (Ps 103,8-10).
Auf dem Konzil in Trient kamen die Konzilsväter zu der Meinung, dass es bei der Ausübung der Seligpreisungen besonders gut sichtbar wird, ob ein Christ das lebt, was er glaubt. Warum? Vielleicht deswegen, weil alle Seligpreisungen eine vertikale und eine horizontale Dimension beinhalten. Eine feste Verbindung zwischen Gott und uns Menschen und eine feste Verbindung zwischen uns Menschen. Am besten wird diese zweifache Verbindung sichtbar und deutlich, wenn wir von dem einen Leib und dem einen Kelch kommunizieren, also die Eucharistie empfangen.
Nun wollen wir zu den anderen, oben erwähnten Fragen kommen. Ist das menschliche Erbarmen überhaupt möglich? Wenn ja, worin erweist es sich?
Wenn wir die Evangelien lesen, finden wir viele Stelle, in denen Menschen, die in Not sind, sich an Jesus wenden. So bitten die zwei Blinden in Mt 9,27: „Hab Erbarmen mit uns, Sohn Davids!“ genauso wie in Mk 10,47 der Bettler Bartimäus; oder eine Mutter, deren Tochter von einem Dämon gequält wurde (Mt 15,22), oder ein Vater, dessen Sohn krank war (Mt 18,15). All diese Menschen erfahren Hilfe von Jesus, weil sie glaubten; ihr Glaube war die Voraussetzung für die jeweilige Heilung. Es gibt aber unter anderen zwei Erzählungen, in denen es nicht darum geht, dass Gott mir seine Güte erweist und Mitleid mit mir hat, sondern wo ich aufgefordert werde selbst zu einem Mitleidenden und Helfenden zu werden. Die erste Stelle ist in Lk 10,25-37; sie handelt von dem barmherzigen Samariter, der sich eines Juden erbarmt und mit ihm Mitleid hat. Seine Zuwendung, seine Hilfeleistung, sein schnelles Handeln, Wein und Öl, die er über die Wunden des fast toten Menschen gießt, werden zu dessen Rettung. Dies ist ein Musterbeispiel auch für unser Leben. Wenn wir mit offenen Augen durch die Welt gehen, werden wir immer wieder alltäglichen, manchmal vielleicht auch schwierigen Notsituationen begegnen, bei denen unsere Hilfe und unser Erbarmen gefordert sind. Haben wir dann den Mut schnell zu handeln? Haben wir dann unseren „Wein“ und „Öl“ dabei, um einen Hilfebedürftigen zu betreuen?
Eine zweite Bibelstelle, die den Zusammenhang, Gott – Mensch und Mensch – Mensch, hervorragend zum Ausdruck bringt, ist das Gleichnis vom unbarmherzigen Diener (Mt 18,23-35). 10 000 Talente (ein Talent = ca. 6.000 bis 10.000 Denare; 1 Denar = ein Tageslohn) und 100 Denare. Merkt ihr den Unterschied? Und was sagt der Herr zum unbarmherzigen Diener, dem so viel erlassen wurde: „Du elender Diener! Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich so angefleht hast. Hättest nicht auch du mit jenem, der gemeinsam mit dir in meinem Dienst steht, Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte?“ Vielleicht kann ich, vielleicht kannst Du in unserem Verhalten Ähnlichkeiten erkennen. Gott erlässt uns unsere unzähligen Schulden, tausende von Denaren (vgl. Vaterunser), wir dagegen können manchmal nicht einmal „einen einzigen Denar“ unserem Mitbruder vergeben. Ist das konsequent? Auch wenn wir die Worte aussprechen „Kύριε ἐλέησον, Herr erbarme dich, bekennen wir uns zu der Treue Gottes, zu seinem Bund mit uns, wir erflehen sein Erbarmen und sein Mitleid mit uns. Dabei dürfen wir aber nie vergessen, dass es auch die horizontale Dimension gibt, mein „Bund“ mit den anderen und mein Umgang mit ihnen. Wir können 1-mal, 3-mal, 12-mal oder sogar 40-mal Kύριε ἐλέησον sprechen oder singen – ein schöner Gesang. Dieser Gesang soll aber nicht nur zu Gott erklingen, sondern auch im Bezug zu unseren Mitmenschen, auch zu mir selbst.