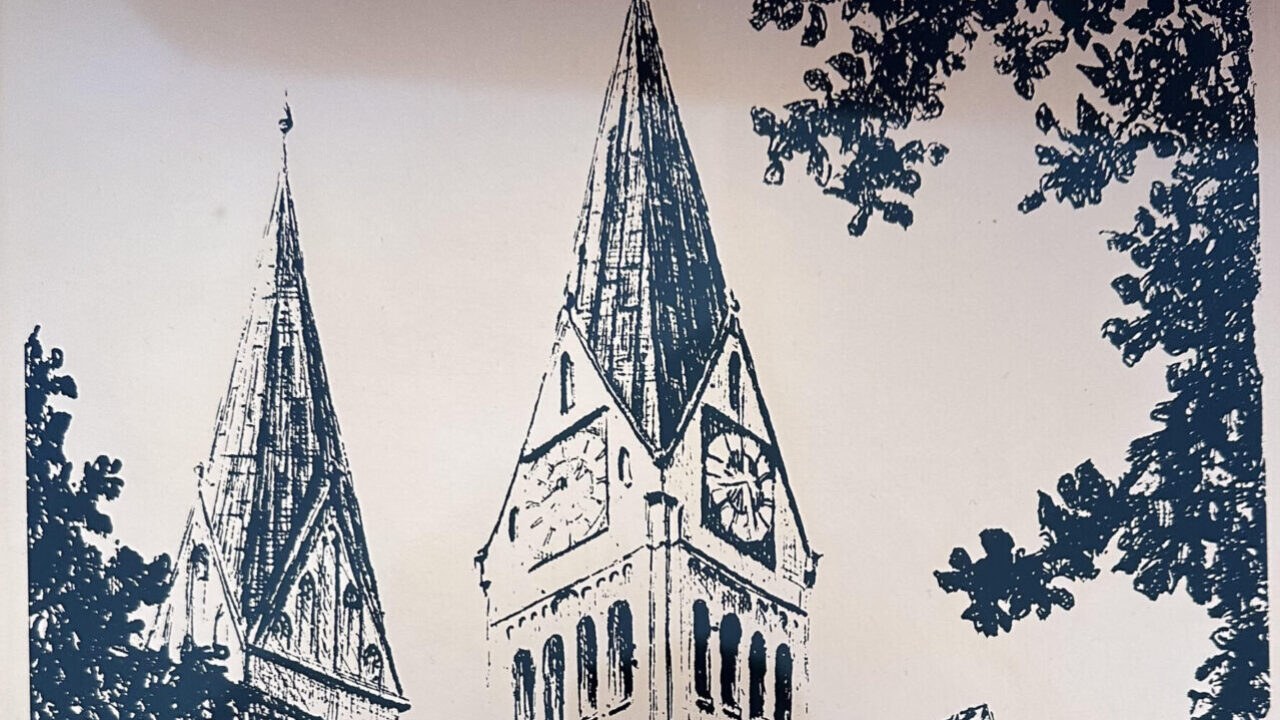Kann sich vielleicht jemand daran erinnern, worüber wir zum ersten Mal in diesem Wintersemester nachgedacht haben? Was war das Thema des geistlichen Impulses? Oder, wenn man sich ein wenig anstrengt, kann sich vielleicht jemand an das Thema vom letzten Mal erinnern? Denn oft kommt es im Leben vor, dass wir vieles vergessen, bewusst oder unbewusst, gewollt oder ungewollt. Wenn wir voll im Alltag beschäftigt sind, kommt sehr oft das Wesentliche zu kurz. Genau über das Wesentliche möchte ich mit Ihnen nachdenken, und zwar über unsere Sendung als Priester und unsere Gemeinschaft mit Christus und miteinander.
„Heilige Unruhe“ und „Gebet für die Verstorbenen“ von den letzten Stillen Abenden können nur als wichtige Signalzeichen für unser heutiges Thema werden: „Sendung des Priesters und Gemeinschaft“ (missio und communio). Christus selbst sendet und bevollmächtigt die Zwölf und lädt zur Gemeinschaft mit ihm und zueinander ein. Bindung an Christus und an das apostolische Zeugnis sowie in Liebe geübte Dienstbereitschaft für alle sind grundlegende Normen, die bis heute aktuell sind und künftig sein werden.
Denn ein Priester als Verkünder des Evangeliums, Diener der Sakramente und Leiter der Gemeinde muss sich seiner Sendung und seines Dienstes bewusst werden. Die Zeit im Priesterseminar oder im Collegium Orientale ist kein Wunschkonzert, sondern eine erste Vorbereitungszeit auf die Weihe und den priesterlichen Dienst. Und wir dürfen nicht zu eng denken, dass mit der Priesterweihe die formatio zu Ende ist. Vielmehr wird der Horizont erst jetzt breiter für mögliche weitere Weihe und Dienste in der Kirche.
Was die Sendung und Gemeinschaft (missio und communio) angeht, bin ich neulich auf einen Artikel von Joachim Wanke[1] gestoßen, den in meiner Erfurter Zeit kennenlernen durfte. Schon damals hochbetagt als emeritierter Bischof von Erfurt hatte ich mit ihm interessante Gespräche. Auf diese Weise las ich den erwähnten Artikel ganz anders, weil damit vieles in Erinnerung gerufen wurde, vor allem in Bezug auf seine Person, seinen Lebensstil, sein Priestersein. Diese persönlichen Gedanken und Erfahrungen möchte ich mit Ihnen teilen:
Erstens es dürfe „im Leben des Priesters zu keiner Spaltung zwischen Christusliebe und apostolischem Eifer kommen“. Denn nur die Beziehung zu Christus alleine, ohne Rücksichtnahme auf den Nächsten führt zu einer egoistischen Beziehung, die sich nur um sich kreist, sozusagen zu einem Selbstzweck wird, zu einem Ofen, der nur sich selbst wärmt. Umgekehrt gute, mag auch freundschaftliche Verhältnisse zu den Nächsten, aber ohne Gott als Drehscheibe im Leben zu haben, landen nur im kumpelhaften, im irdischen Sinnen.
Zweitens: Der Priester kann nur Priester sein und überzeugend Priester bleiben, wenn es ihm gelingt, sein priesterliches Sein und seine Sendung in ein ausgewogenes Verhältnis zu bringen. Anders gesagt: Der Dienst des Priesters muss von dem gespeist sein, was den Priester selbst erfüllt. Ich würde noch dazu hinfügen und Ihnen ans Herz legen, dass dieser Ernährungsprozess bereits noch lange vor der Weihe beginnt, im Priesterseminar zum Beispiel. Um überzeugend seine Mission, ja seine Sendung in die Welt zu tragen, muss der Priester in einer vertrauten und engen Gemeinschaft (communio) mit Gott verbunden sein. Der Bischof Wanke betonte immer wieder, dass ein Priester nach »außen« und Priester nach »innen«, wirksam in die Welt hineinwirken muss. Er muss missionarischer « Priester sein und »kirchlicher« Priester werden, wobei das eine das andere bedingt. Die Sendung des Priesters lebt nicht allein aus den wissenschaftlichen Qualifikationen, Erfolgen oder etwa aus den hervorragenden Promotionsabschlüssen, sondern vielmehr aus der inneren gläubigen Einstellung und der tiefen Gemeinschaft mit Christus, die aber nur im Gebet und im Vertrauen zu erwerben ist.
Anders gesagt: Für unseren konkreten Dienst hat all das den Vorrang, was unsere Christusverbundenheit stärkt und lebendig erhält. Was könnten wir denn anderes der Welt bringen als Christus und sein im Heiligen Geist vom Vater ermächtigtes Lebensangebot? Etwa uns selbst? Bestimmt nicht!
Damit unsere Sendung Bestand hat, muss es uns also darum gehen, Christus durch unser Leben ausstrahlen zu lassen. Er muss an unserem privaten Tun, an unserem Dasein erkennbar werden, nicht irgendwann, sondern hier und jetzt in dieser vorweihnachtlichen Zeit im Jahre 2023. Er muss in die Mitte unserer Lebensvollzüge eindringen, in den Freundeskreis, auch in unsere Schattenseiten. Es ist darum keine Randfrage meines Daseins, wenn ich zwar vorbildlich im Studium bin, gute Noten hervorbringe und vieles an der Uni leisten kann, aber doch keinen inneren Frieden habe, keine Zufriedenheit, da es mir nicht gelingt, mein geistliches Leben in Griff zu halten. In Joh 17,21 wird die Glaubwürdigkeit der Sendung Christi an seine Einheit mit dem Vater gekoppelt. Die Glaubwürdigkeit und »Effizienz« unserer Sendung also wird in ähnlicher Weise von der Kraft zur Einheit mit dem Herrn, der uns in vielfacher Gestalt seine Gegenwart schenkt, abhängen. Ich bringe ein Bespiel von einem Baum. Je höher und weiter ein Baum seine Zweige ausstrecken will, desto fester muss er in der Erde verwurzelt sein. Die geistliche Stabilität und tiefe Wurzeln kann uns nur Christus schenken. Das heißt die eigene Lebenssituation in der Kraft des Evangeliums anzunehmen und zu bewältigen.
Vor diesem Hintergrund wird auch die Verkündigung des Evangeliums befestigt. Wir sind die ersten Hörer unserer Verkündigung. Die Überzeugungskraft unserer Botschaft also hängt davon ab, ob wir dem Evangelium im eigenen Leben eine reale Chance des Gelingens einräumen.
Viele Menschen werden uns die Frage stellen: Geht das überhaupt, wovon du in deiner Predigt redest? Ist das lebbar, was das Evangelium rät? Um dem Vorwurf zu entgehen, „das Wasser predigen und den Wein selber trinken“, bedarf es von Priestern und auch schon jetzt von den Priesterkandidaten, des lebendigen Glaubenszeugnisses und der Erfahrungen. Der Altbischof von Erfurt brachte oft ein Bespiel von einem Taucher. Wer zum ersten Mal im tiefen Schwimmpool schwimmen soll, wird in ähnlicher Weise von einer berechtigten Frage gepackt, ob das Wasser trägt oder ob man darin untergeht. Erst wenn einer vom Wasser her einladend und aufmunternd winkt, wird dieser eine den Mut fassen, in den Wasserpool einzusteigen, Schwimmen lernen und später in die Tiefe einzutauchen. Und ohne dieses Wagnis kommt es bekanntlich nicht zur Erfahrung, dass das Wasser trägt. Es ist natürlich für die Schuler gleich verdächtig, wenn ihr Schwimmlehrer nur am Rande des Beckens stehen bleibt und Trockenübungen demonstriert, anstatt im Tiefwasser zu schwimmen. Übertragen auf unseren Dienst heißt das: Wenn ich nicht zutiefst überzeugt bin, dass mich selbst das Evangelium »trägt«, werde ich nicht andere dazu bewegen können, sich auf dieses Wort einzulassen.
Drittes und letztes: Die Intensität des Verkündigungsdienstes im umfassenden Sinn, also der Ausstrahlungskraft unserer Botschaft nach »Außen« wird von der Kraft abhängen, mit der wir das Evangelium im »Innenraum« unseres eigenen Lebens und unseres kirchlichen Lebenshorizontes integrieren können. Da helfen uns keine Hinweise auf Kirchenväter oder fromme Spruche aus der Philokalia, vielmehr wird jeder herausgefordert, das eigene Glaubenszeugnis abzulegen und danach wird eingeschätzt, ob das Evangelium »geht« oder »nicht geht«.
Diese Grundfigur der Evangeliumsverkündigung mag uns zu schaffen machen, letztlich aber ist sie zu unserem Heil. Gott selbst sorgt dafür, dass wir nicht zu Funktionären seiner Botschaft werden, sondern zum »Salz der Erde« (vgl. Mt 5, 13). Es ist ein Wort der Zuversicht. Wahres Salz wird immer anziehend sein. Es spricht für sich und braucht keine Reklame. Das beste Mittel, als Priester, als Seminarist in der rechten Spannung zwischen missio und communio zu bleiben, ist darum die Bereitschaft, sich der Beurteilung durch die Umwelt auszusetzen. Wir dürfen darauf vertrauen, dass uns geholfen werden wird, ganzheitlich unser Sein und unsere Sendung zu leben. Christusliebe und apostolischer Eifer, ja „heilige Unruhe“ – beide Dimensionen unserer priesterlichen Existenz gehören zusammen und müssen schon hier und jetzt eingeübt werden. Amen.
[1] J. Wanke, Communio und missio, in: Arbeitshilfen Nr. 36, Hrsg. Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, 18-25.